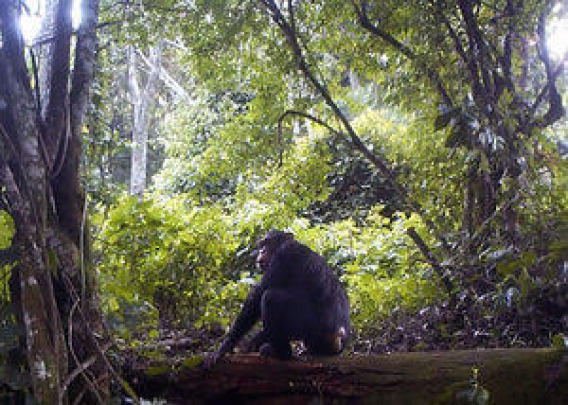News
Wie Soziale Medien zum Artenschutz beitragen können
30.10.2023
Fotos von Tier- und Pflanzenarten, die in den Sozialen Medien geteilt werden, können einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Biodiversität leisten – vor allem in tropischen Gebieten. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für Biodiversitätsforschung (iDiv), des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), der Friedrich-Schiller-Universität Jena und der Universität von Queensland (UQ). In drei Studien, die in den Fachmagazinen BioScience, One Earth und Conservation Biology veröffentlicht wurden, zeigen sie am Beispiel Bangladeschs, dass Facebook-Daten einen wichtigen Beitrag zum Biodiversitätsmonitoring und zur Bewertung potenzieller Schutzgebiete leisten können.
Die Tropen sind Hotspots der Biodiversität – doch unser Wissen über die Bestände von Tier- und Pflanzenarten in diesen Regionen ist lückenhaft. Während Monitoringprogramme und Citizen-Science-Initiativen in den Industrieländern gut etabliert sind, sind sie in den Entwicklungsländern noch kaum verbreitet. Doch nur mit einer möglichst genauen Dokumentation der Biodiversität kann festgestellt werden, welche Arten eines besonderen Schutzes bedürfen. Mit der zunehmenden Nutzung Sozialer Medien und der Verbreitung qualitativ hochwertige Digitalkameras könnten sich neue Möglichkeiten ergeben. Naturphotographen weltweit teilen ihre Aufnahmen zur Biodiversität in den Sozialen Medien – ein riesiges Potenzial. Ein Forschungsteam hat am Beispiel des südasiatischen Landes Bangladesch untersucht, welchen Beitrag Daten von Facebook zum Monitoring und in der Konsequenz auch zur Einschätzung potenzieller Schutzgebiete leisten können.
Für ihre Studie griffen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf Facebook-Gruppen von Naturphotographen in Bangladesch zurück. Die Informationen, die sie aus den Art- und Ortsangaben der Fotos ableiten konnten, flossen in einen gemeinsamen Datenpool mit den Daten aus der Global Biodiversity Information Facility (GBIF). Die GBIF wird unter anderem aus etablierten Citizen-Science-Plattformen wie eBird und iNaturalist gespeist. Im Globalen Norden funktioniert das schon – für Tier- und Pflanzenarten in den Entwicklungs- und Schwellenländern gibt es hingegen noch deutlich weniger Daten. Durch die Integration der Facebook-Daten konnte das Forschungsteam über 44.000 Datensätze für fast 1000 Tierarten zusammentragen, wovon 288 laut Weltnaturschutzorganisation IUCN als gefährdet gelten. Mehr als ein Viertel der Daten stammte aus Facebook-Gruppen, für Schmetterlinge und Vögel war es sogar mehr als die Hälfte. „Hätten wir nur auf die Daten aus der GBIF zurückgegriffen, wären uns Daten zur Verbreitung von Hunderten bedrohter Tierarten durch die Lappen gegangen“, meint Dr. Shawan Chowdhury, der die Studien in Bangladesch leitete. Derzeit forscht er am iDiv, dem UFZ und der Friedrich-Schiller-Universität Jena; seine Doktorarbeit schrieb er an der Universität von Queensland in Australien.
Das Forschungsteam konnte auf dieser neuen Datenbasis eine Karte besonders geeigneter Lebensräume für die verschiedenen Tierarten erstellen und mit bestehenden Schutzgebieten abgleichen. Derzeit sind lediglich 4,6 % der Landfläche Bangladeschs als Schutzgebiete ausgewiesen, wovon sich ein Großteil im Südwesten des Landes befindet. Insbesondere bereits bedrohte Arten werden von den derzeitigen Schutzgebieten nicht ausreichend abgedeckt – ein typisches Phänomen in Tropenregionen. Um sicherzustellen, dass für alle bedrohten Arten in Bangladesch ausreichend Schutzgebiete vorhanden sind, müsste der Anteil der unter Schutz stehenden Fläche auf 39 Prozent erhöht und diese besser im Land verteilt werden. Die Daten zeigten zudem, dass zum Beispiel 45 % der Schmetterlingsarten in Bangladesch auf den Grünflächen der Hauptstadt Dhaka vorkamen, fast die Hälfte davon gilt als gefährdet. Bei der Planung neuer Schutzgebiete könnte sich daher auch ein Blick auf eher unkonventionelle Gebiete lohnen, etwa in und um urbane Gebiete.
Doch die Nutzung von Social-Media-Daten birgt derzeit noch einige Herausforderungen. Wie bei vielen Citizen-Science-Initiativen sind die Daten, die von den Nutzern gesammelt werden, nur selten gleichmäßig verteilt. Stattdessen konzentrieren sie sich oft auf gut erreichbare Regionen, etwa in der Nähe von Städten. Social-Media-Daten für die Forschung nutzbar zu machen, ist außerdem derzeit noch sehr aufwendig. Für ihre Studie durchsuchten die Forschenden die Facebook-Gruppen händisch nach den Arten auf der Roten Liste und verifizierten jedes einzelne Foto inklusive Art- und Ortsangabe. Neue Möglichkeiten wie Künstliche Intelligenz und Deep Learning könnten diesen Prozess zukünftig einfacher machen.
„Die Integration von Biodiversitätsdaten aus Citizen Science, die in den Sozialen Medien veröffentlich werden, birgt insbesondere für tropische Regionen ein großes Potential, wo es an verlässlichen und aktuellen strukturierten Monitoringdaten mangelt“, sagt Prof. Aletta Bonn, Leiterin der Forschungsgruppe Ökosystemleistungen am UFZ, an der Universität Jena und bei iDiv. In diesen Regionen könnten Sichtungen, die bei Facebook oder auch auf anderen sozialen Plattformen veröffentlich werden, zu einer besseren und systematischen Einschätzung potenzieller Schutzgebiete beitragen – ein wichtiger Schritt, um die Ziele von Kunming-Montreal zu erreichen und 30 Prozent der Land- und Meeresfläche bis 2030 unter Schutz zu stellen.
(Kati Kietzmann) Original publications
(Researchers with iDiv affiliation and alumni in bold)
Shawan Chowdhury, Upama Aich, Md Rokonuzzaman, Shafiul Alam, Priyanka Das, Asma Siddika, Sultan Ahmed, Mahzabin M. Labi, Moreno Di Marco, Richard A. Fuller, Corey T. Callaghan (2023). Increasing biodiversity knowledge through social media: a case study from tropical Bangladesh. BioScience; DOI: 10.1093/biosci/biad042
Shawan Chowdhury, Richard A. Fuller, Md. Rokonuzzaman, Shofiul Alam, Priyanka Das, Asma Siddika, Sultan Ahmed, Mahzabin Muzahid Labi, Sayam U. Chowdhury, Sharif A. Mukul, Monika Böhm, Jeffrey O. Hanson (2023). Insights from citizen science reveal priority areas for conserving biodiversity in Bangladesh. One Earth; DOI: 10.1016/j.oneear.2023.08.025
Shawan Chowdhury, Richard A. Fuller, Sultan Ahmed, Shofiul Alam, Corey T. Callaghan, Priyanka Das, Ricardo A. Correia, Moreno Di Marco, Enrico Di Minin, Ivan Jarić, Mahzabin Muzahid Labi, Richard J. Ladle, Md. Rokonuzzaman, Uri Roll, Valerio Sbragaglia, Asma Siddika, Aletta Bonn (2023). Using social media records to inform conservation planning. Conservation Biology, DOI: 10.1111/cobi.14161
Bereits wenig künstliches Licht gefährdet Ökosysteme
30.10.2023
Nächtliche Lichtverschmutzung gefährdet ober- und unterirdische Ökosysteme mit Konsequenzen für deren Stabilität und menschliches Wohlergehen
Eine neue Sammlung von Studien über künstliches Licht bei Nacht zeigt, dass die Auswirkungen der Lichtverschmutzung weitreichender sind als gedacht. Selbst geringe Mengen künstlichen Lichts können Artengemeinschaften und ganze Ökosysteme stören.
Die in der Fachzeitschrift Philosophical Transactions of the Royal Society B veröffentlichte Sonderausgabe mit 16 wissenschaftlichen Studien befasst sich mit den Auswirkungen der Lichtverschmutzung auf komplexe Ökosysteme, darunter Boden-, Grasland- und Insektengemeinschaften. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena betonen in der Sonderausgabe den Dominoeffekt, den Lichtverschmutzung auf Funktionen und Stabilität von Ökosystemen haben kann.
Weltweit nimmt künstliche Beleuchtung zu – auch der Nachthimmel wird damit immer heller. Die Lichtverschmutzung, die jedes Jahr um bis zu zehn Prozent zunimmt, unterbricht die natürlichen
Lichtzyklen, die im Laufe der Erdgeschichte weitgehend konstant waren. Diese Zyklen sind für Organismen, die auf Licht als Energie- und Informationsquelle angewiesen sind, lebenswichtig. Bislang
konzentrierten sich Studien, die die Auswirkungen von Lichtverschmutzung untersucht haben, weitgehend auf die menschliche Gesundheit und auf einzelne Arten. Die Untersuchung ganzer Ökosysteme, in
denen Arten durch vielfältige Interaktionen miteinander verbunden sind, blieb hingegen meist außen vor. „Arten existieren nicht isoliert, sondern interagieren auf vielfältige Weise“, erklärt Dr.
Myriam Hirt von iDiv und der Universität Jena, die gemeinsam mit Dr. Remo Ryser die Herausgabe der Sonderausgabe redaktionell leitete. „Unser Ziel war es, besser zu verstehen, wie sich die Aufhellung
des Nachthimmels auf ganze Ökosysteme und die damit verbundenen Ökosystemleistungen auswirkt.“
Mithilfe des iDiv-Ecotrons, das aus mehreren kontrollierbaren Ökosystemen (sogenannten EcoUnits) besteht, simulierten und veränderten die Forscherinnen und Forscher die nächtlichen Lichtverhältnisse.
Zu den wichtigsten Ergebnissen in diesem Zusammenhang gehören: Die Auswirkungen von künstlichem Licht erreichen auch unterirdische Bodengemeinschaften und beeinflussen die Bodenatmung sowie die
Effizienz der Kohlenstoffnutzung. Künstliches Licht beeinflusst die Aktivität von Insekten, was unter anderem zu höheren Prädationsraten in der Nacht führte, es gab also mehr Jagdverhalten.
Künstliches Licht führt zu einer Verringerung der pflanzlichen Biomasse und Diversität, sowie zu Veränderung von Pflanzenmerkmalen, wie die Behaarung der Blätter
Durch künstliches Licht können sich die Zeiträume, in denen Arten aktiv sind, verschieben bzw. angleichen, was zu größeren Überschneidungen in deren Aktivität führt und letztlich den Fortbestand von Arten beeinflussen kann.
Die Studien zeigten auch, dass selbst geringe Intensitäten der Lichtverschmutzung – weniger als bei Vollmond – tiefgreifende Auswirkungen haben, nicht nur auf das Verhalten und die physiologischen
Reaktionen einzelner Arten, sondern sich auch auf komplexeren Ebenen widerspiegeln, etwa in Gemeinschaften und ökologischen Netzwerken, wie zum Beispiel Nahrungsnetzen. „Wie die einzelnen Arten auf
künstliches Licht reagieren und in welcher Beziehung sie zueinander stehen, beeinflusst, wie das gesamte Ökosystem reagiert. So verändert beispielsweise eine Verschiebung der Aktivität von tagaktiven
und dämmerungsaktiven Arten in die Nacht die Aussterberisiken in der gesamten Artengemeinschaft“, sagt Dr. Remo Ryser von iDiv und der Universität Jena.
Eine weitere Studie in der Sonderausgabe untersuchte, wie künstliches Licht indirekte Kaskadeneffekte hervorruft, die sich auch auf den Menschen auswirken. So kann künstliches Licht bei Nacht zum
Beispiel die Häufigkeit und das Verhalten von Stechmücken beeinflussen. Die Studie zeigt, dass künstliches Licht zu Veränderungen in der zeitlichen Abfolge wichtiger Verhaltensweisen der Mücken
führt, wie der Wirtssuche, der Paarung und der Flugaktivität. Dies könnte weitreichende Folgen für die Übertragung von Krankheiten wie Malaria haben. In einer anderen Studie wurde untersucht, wie
verschiedene Beleuchtungsstrategien die negativen Auswirkungen von künstlichem Licht abmildern können. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weisen jedoch darauf hin, dass die Eindämmung von
Lichtverschmutzung einen nuancierten Ansatz erfordert, da die Auswirkungen auf die verschiedenen Arten sehr unterschiedlich sein können. Entsprechend könnten vorbeugende Maßnahmen möglicherweise
nicht universell anwendbar sein.
(Christine Coester)
Originalpublikation
(Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit iDiv-Affiliation fett gedruckt)
Myriam R. Hirt, Darren M. Evans, Colleen R. Miller, Remo Ryser (2023). Light pollution in complex ecological systems. Philosophical Transactions of the Royal Society B, DOI: https://doi.org/10.1098/rstb/378/1892
|
|
||||
|
Jahrzehntelange Naturbeobachtungen enthüllen ein möglicherweise universelles Muster der globalen Artenhäufigkeit (08.09.2023) Die meisten Arten sind selten, aber nicht sehr selten, und nur wenige Arten sind sehr häufig. Diese sogenannte „globale Artenhäufigkeitsverteilung“ ist für intensiv untersuchte Artengruppen wie die Vögel mittlerweile lückenlos erfasst. Für andere Artengruppen wie die Insekten ist das Muster noch unvollständig. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forscherteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der University of Florida (UF). Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlicht. Sie zeigt, wie wichtig das Monitoring der Biodiversität ist, um die globale Artenhäufigkeit zu bestimmen und ihren Wandel zu verstehen.
Wissenschaftler haben im vergangenen Jahrhundert zwei bedeutende gSAD-Modelle vorgeschlagen: Laut dem Modell von R. A. Fisher, einem Statistiker und Biologen, sind sehr seltene Arten (solche mit wenigen Individuen) am häufigsten, und die Zahl der Arten nimmt ab, je mehr Individuen es von ihnen gibt (Log-Serien-Modell). F. W. Preston, ein Ingenieur und Ökologe, meinte dagegen, dass nur wenige Arten sehr selten sind und die meisten Arten eine mittlere Häufigkeit (an Individuen) aufweisen (Log-Normal-Modell). Trotz jahrzehntelanger Forschung wussten die Wissenschaftler bis heute nicht, welches Modell die globale Artenhäufigkeit am zutreffendsten beschreibt. Klar war, dass sich dieses Problem nur mit sehr vielen Daten lösen lässt. Die Autoren der Studie nutzten die Global Biodiversity Information Facility (GBIF) mit über einer Milliarde Artenbeobachtungen zwischen 1900 und 2019.
„Die GBIF-Datenbank ist eine fantastische Ressource für verschiedenste Fragen der Biodiversitätsforschung, vor allem deshalb, weil sie Daten aus der professionellen Forschung mit Daten von Bürgerwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern aus der ganzen Welt zusammenführt“, sagt Erstautor Dr. Corey Callaghan. Er begann die Studie bei iDiv und an der MLU und arbeitet jetzt an der UF.
Die Forscher fanden ein potenziell universelles Muster, das erkennbar wird, sobald die Artenhäufigkeitsverteilung vollständig enthüllt ist: Die meisten Arten sind selten, aber nicht sehr selten, und nur wenige Arten sind sehr häufig – so wie es Prestons Log-Normal-Modell vorhersagt. Die Forscher stellten auch fest, dass dieses Muster erst für wenige Artengruppen wie Vögel oder Palmfarne vollständig enthüllt worden ist. Für alle anderen Artengruppen sind die Daten noch zu unvollständig.
„Wenn man nicht genügend Daten hat, sieht es so aus, als ob die meisten Arten sehr selten sind“, sagt der Letztautor der Studie, Prof. Henrique Pereira, Forschungsgruppenleiter bei iDiv und an der MLU. „Aber wenn neue Beobachtungen hinzukommen, ändert sich das Bild. Dann sieht man, dass es tatsächlich mehr seltene als sehr seltene Arten gibt. Wir können diese Verschiebung sehr schön für Palmfarne und Vögel sehen, wenn wir die Artenbeobachtungen von 1900 bis heute vergleichen. Es ist faszinierend: Man sieht die sukzessive Enthüllung der wahren globalen Artenhäufigkeitsverteilung, so wie Preston sie vor vielen Jahrzehnten vorhergesagt hat. Wir sehen jetzt, dass er richtig lag.“
„Obwohl wir seit Jahrzehnten Arten beobachten und Daten sammeln, haben wir das typische Muster erst für wenige Artengruppen enthüllt“, so Callaghan. Die neue Studie hilft den Wissenschaftlern, den Enthüllungsgrad der Artenhäufigkeitsverteilungen abzuschätzen. Dies wiederum könnte eine weitere, langjährige Forschungsfrage beantworten: Wie viele Arten gibt es insgesamt auf der Erde? Die Studie zeigt, dass für einige Gruppen (Vögel, Palmfarne) fast alle Arten entdeckt und beschrieben worden sind, für andere (Insekten, Kopffüßer …) dagegen nicht.
Die Forscher glauben, dass ihre Ergebnisse dazu beitragen könnten, Darwins Frage zu beantworten, warum manche Arten selten und andere häufig sind. Das von ihnen teilweise enthüllte, möglicherweise universelle Muster könnte auf grundlegende Mechanismen hinweisen, welche die unterschiedlichen Artenhäufigkeiten erklären. Während weiter geforscht wird, verändert unser Handeln die Häufigkeit von Arten. Dies erschwert die Aufgabe der Forscher: Sie müssen nicht nur verstehen, wie sich Artenhäufigkeiten natürlicherweise entwickeln, sondern auch wie sie gleichzeitig vom Menschen verändert werden.
Original-Publikation: |
||||
Fahrspuren im Wald schützen bedrohte Gelbbauchunke
04.10.2022
Sie sehen nach Zerstörung aus, schaffen aber wichtige Lebensräume: Fahrspuren auf Rückegassen im Wald. Die Gelbbauchunke braucht diese zum Überleben. Mit ihren herzförmigen Pupillen und dem
gelb-schwarz gemusterten Bauch ist sie ein besonderer, aber mittlerweile seltener Anblick in süddeutschen Wäldern. Sie ist stark gefährdet und streng geschützt. Herkömmliche Maßnahmen zum
Amphibienschutz eignen sich allerdings nicht zum Schutz der Pionierart Gelbbauchunke. Nun haben Forschende der Universität Hohenheim in Stuttgart ein nachhaltiges Schutzkonzept zur Herstellung von
Laichgewässern für die bedrohte Art erarbeitet. Sie empfehlen, Schutzmaßnahmen in die Waldbewirtschaftung zu integrieren. Infos und Praxis-Leitfaden: https://www.unkenschutz-bw.de
Schlammige Pfützen auf zerfurchten Waldwegen: Die Spuren der Forstwirtschaft stören das Bild einer vermeintlich unberührten Natur im Erholungsgebiet Wirtschaftswald. Der gefährdeten Gelbbauchunke
bieten solche Fahrspuren jedoch eine unverzichtbare Möglichkeit zur Vermehrung. Das zeigen die Ergebnisse eines Forschungsprojekts der Universität Hohenheim.
Der globale Verbreitungsschwerpunkt der Gelbbauchunke liegt in Süddeutschland – daher trägt Deutschland eine besondere Verantwortung für den weltweiten Erhalt dieser Art. Die Forschenden fanden
heraus, dass die gefährdete Unke langfristig nicht von herkömmlichen Maßnahmen im Amphibienschutz profitiert, sondern spezielle Schutzkonzepte benötigt. Der Grund dafür: Die Pionierart kann sich nur
in neu entstandenen, kurzlebigen Kleinstgewässern erfolgreich vermehren. Nur unmittelbar nach der Entstehung sind derartige Gewässer frei von Fressfeinden.
Die Dynamik des Entstehens und Vergehens von Kleinstgewässern war ursprünglich besonders in Auenlandschaften mit deren regelmäßigen Überschwemmungen gegeben. Da solche Landschaften in Deutschland
immer seltener werden, zieht es die Gelbbauchunke in Lebensräume, die eine ähnliche Störungsdynamik aufweisen – wozu die Wirtschaftswälder zählen.
Waldnutzung schafft seltene Laichgewässer
„Fahrspuren von Waldmaschinen auf Rückegassen schaffen ideale Laichgewässer für die Gelbbauchunke“, sagt Prof. Dr. Martin Dieterich, Leiter des Forschungsprojekts zum nachhaltigen Schutz der
Gelbbauchunke. Innerhalb des ersten Jahres dienen solche Fahrspuren als Lebensstätte, in der sich die bedrohte Art vermehren kann. Da Wirtschaftswälder im Zuge der Holzernte regelmäßig befahren
werden, entstehen Laichgewässer immer neu. Die Ergebnisse des Forschungsprojekts belegen: Die Gelbbauchunke vermehrt sich in diesen neuen Pfützen besonders erfolgreich.
Von dauerhaft angelegten Gewässern zum Amphibienschutz profitiert die Gelbbauchunke langfristig nicht. „In Baggertümpeln vermehrte sich die Gelbbauchunke im ersten Untersuchungsjahr zwar besonders
gut“, berichtet Felix Schrell, Koordinator des Forschungsprojekts. Aber: „Bereits im zweiten Jahr siedeln sich in diesen permanenten Gewässern auch Fressfeinde der Gelbbauchunke an. Der Nachwuchs der
Pionierart hat dann keine Chance mehr zu überleben. Auch eine Sanierung dieser Gewässer, wie es für die Gelbbauchunke oft betrieben wird, bringt keinen populationserhaltenden
Reproduktionserfolg.“
Forscher empfehlen Integration des Artenschutzes in Waldnutzung
Die Empfehlung lautet: Fahrspuren im Wald sollen während der Laichsaison der Gelbbauchunke über den Sommer erhalten bleiben und dann eingeebnet werden. Durch gezieltes Befahren der Gassen können die
Spuren anschließend wieder neu entstehen.
Da die Fahrspuren bei Waldarbeiten ohnehin entstehen, fällt in der Forstwirtschaft kein besonderer Mehraufwand für den Artenschutz an. „Eine Win-Win-Situation für die Gelbbauchunke und für die
Bewirtschafter“, fasst Prof. Dr. Dieterich zusammen. Um Laichgewässer auch außerhalb der Rückegassen zu schaffen, können im Frühjahr zudem Fahrspuren auf Wildäckern angelegt und im Zuge der regulären
Bodenbearbeitung im Herbst wieder beseitigt werden.
Integrierter Artenschutz erfordert Akzeptanz in Bevölkerung und Naturschutz
Oft werden Fahrspuren auf Rückegassen unmittelbar nach den Waldarbeiten eingeebnet oder die Gassen vorbeugend mit Reisig bedeckt, sodass sich keine Pfützen bilden. Dadurch versuchen Forstleute
mögliche Beschwerden aus der Bevölkerung oder von Naturschutzverbänden zu vermeiden – denn in der öffentlichen Wahrnehmung gelten die Fahrspuren gemeinhin als Zerstörung des Ökosystems Wald. „Dabei
wird vergessen, dass Rückegassen gerade für den Bodenschutz im Wald ausgewiesen werden“, gibt Prof. Dr. Dieterich zu bedenken. „Denn so bleibt die Befahrung von Waldböden zur Holz-Ernte auf die
Rückegasse beschränkt. Die bereits vorgeschädigten Bereiche dienen im Fall der Gelbbauchunke dem Artenschutz.“
Die fehlende Akzeptanz erschwert einen nachhaltigen Schutz der Gelbbauchunke. „Wir möchten der Bevölkerung vermitteln: Artenschutz und Waldbewirtschaftung passen bei der Gelbbauchunke zusammen“, sagt
Felix Schrell. Ein wichtiger Aspekt des Schutzkonzepts ist daher die Öffentlichkeitsarbeit: Mit Exkursionen, Vorträgen, Flyern und Infotafeln informiert das Projekt über den Nutzen der
Fahrspuren.
HINTERGRUND: Forschungsprojekt zum Schutz der Gelbbauchunke
Das Projekt „Entwicklung nachhaltiger Schutzkonzepte für die Gelbbauchunke in Wirtschaftswäldern“ erforschte zwischen 2019 und 2021 Maßnahmen zum Schutz der Gelbbauchunke. Dabei wurde das
Wasserhaltevermögen verschiedener Kleingewässer sowie die tatsächliche Reproduktionszahl der Gelbbauchunke in den Gewässern untersucht.
Sorge um Grasfrosch und Erdkröte wächst
19.09.2022
Eine Auswertung der diesjährigen Amphibienwanderung in Bayern und eine genauere Auswertung der vorangegangenen Jahre zeigt: An den Amphibienzäunen werden jedes Jahr weniger Grasfrösche gefunden und die Erdkrötenbestände stagnieren auf niedrigem Niveau. Angesichts der diesjährigen Trockenheit ist zudem in 2023 eine weitere rapide Abnahme zu befürchten.
Der BUND Naturschutz in Bayern (BN) hat neben den Daten für dieses Jahr auch weiteres Zahlenmaterial aus den vorangegangenen Jahren von 2019 bis 2021 ausgewertet. In die Analyse flossen Daten von 342
Wanderwegen aus 40 Landkreisen und Städten ein. In den drei trockenheitsgeprägten Jahren 2019 bis 2021 hat der Erdkrötenbestand gegenüber den zwölf Jahren davor (2007 bis 2018) um 18 Prozent
abgenommen, der Grasfroschbestand gar um 28 Prozent. Der Blick auf die Daten, die aus dem Jahr 2022 bereits vorliegen, offenbart im Vergleich dazu eine weitere alarmierende Abnahme um 18 Prozent beim
Grasfrosch. Erdkröten waren es wieder etwas mehr als 2021 (plus 11 Prozent), die Bestände sind aber noch immer weit vom langjährigen Mittel entfernt.
Tiefgreifende flächendeckende Landschaftseingriffe wie großflächige Entwässerung, Beseitigung zahlloser Kleingewässer, Flurbereinigung und Zerstörung von Feuchtgebieten und Auen haben bereits in der
Vergangenheit die Amphibien in Bayern massiv dezimiert. Mit der Klimakrise stehen wir nun vor einem zweiten dramatischen Rückgang. Geringe Niederschläge führen zu niedrigen Wasserständen in den
Laichgewässern der Amphibien. Trocknen sie bei ausbleibenden Frühjahrsniederschlägen aus, gehen Laich und Kaulquappen zugrunde. Die trockene Landschaft bietet zudem für die Hüpferlinge, also die das
Gewässer verlassenden Jungtiere, sehr ungünstige Bedingungen. Viele verenden schon auf dem Weg vom Laichgewässer in den Sommerlebensraum. In trockenen Sommern können sich die Amphibien-Weibchen auch
weniger Reserven anfressen, die aber für die Paarungsbereitschaft notwendig sind.
Hintergrund:
Aktive des BN betreuen jedes Jahr im Frühjahr in ganz Bayern über 600 Amphibienzäune, die an den die Wanderwege zwischen Sommerlebensraum und Laichgewässer kreuzenden Straßen aufgestellt werden.
Dabei prüfen Sie bis zu acht Wochen lang bei Wind und Wetter morgens und abends die an den Fangzäunen eingelassenen Eimer, notieren sich die Anzahl der darin vorkommenden Arten und bringen sie sicher
über die Straße. Mit tausenden von Helfer/innen und jährlich bis zu 500.000 vor dem Straßentod geretteten Tieren ist es Europas größte Artenrettungsaktion.
Für die zentrale Erfassung der Daten gibt es die BN-Amphibiendatenbank auf https://www.bund-naturschutz.de/tiere-in-bayern/amphibien/wanderwege
Miscanthus und Wildblumen für nachhaltige Bioenergie vom Acker
12.09.2022
Studie mit Beteiligung der Uni Hohenheim zeigt positive Effekte einer Beimischung von Blühpflanzen zu Miscanthus bei der energetischen Nutzung.
Ein Plus für die Artenvielfalt – und zugleich bessere Verbrennungseigenschaften, so die Idee: Blühpflanzen wirken sich bei der Energieerzeugung mit Miscanthus rundum positiv aus. Das
hochwachsende Gras ist eine wichtige Biomasse-Pflanze in der Bioökonomie, besonders auch zur Energiegewinnung. Um die biologische Vielfalt zu fördern, könnte Miscanthus gemeinsam mit
einheimischen, mehrjährigen Blühpflanzen wie Rainfarn, Beifuß, Wilde Karde und Gelber Steinklee angebaut werden. Ein Team von Forschenden der Universität Hohenheim in Stuttgart, des
Forschungszentrums Jülich und der Hunan Agricultural University in China hat nun untersucht, wie sich – neben dem Plus für das Ökosystem – die vier ausgewählten Wildpflanzenarten als Additive auf die
Verbrennung von Miscanthus zur Energieerzeugung auswirken. Erste Ergebnisse sind jetzt in einer Studie in der renommierten Fachzeitschrift „Renewable and Sustainable Energy Reviews“
erschienen: https://doi.org/
Miscanthus ist eine sogenannte ausdauernde Pflanze: Sie überdauert mehrere Jahre und treibt immer wieder aus. Sie kann je nach Standortgüte über 15 bis 20 Jahre genutzt werden und
erreicht eine Höhe von über drei Metern. Verwendet wird die Biomasse der Pflanze zum einen in Form von Pellets oder Briketts zur Energiegewinnung mittels Verbrennung. Zum anderen kommt sie als
Rohstoff für die Industrie zum Einsatz, zum Beispiel für Bau- und Dämmstoffe oder in der Zellstoffindustrie. In Deutschland wird Miscanthus gegenwärtig auf etwa 4.500 Hektar Fläche
angebaut.
In einer projektunabhängigen Kooperation verwendeten die Wissenschaftler:innen der Universität Hohenheim, der Hunan Agricultural University und der Jülicher Institute für Pflanzenwissenschaften sowie
Werkstoffstruktur und -eigenschaften für ihre Studie Rohstoffproben von Miscanthus sowie von vier ausgewählten heimischen Wildpflanzenarten. Ihr Ziel war es, die Verbrennungseigenschaften
sowie den höheren Heizwert unterschiedlicher Mischungen zu untersuchen.
Mehr Artenvielfalt auf dem Acker
Die Wildpflanzen waren Wilde Karde und Gelber Steinklee (zweijährig) sowie Rainfarn und Beifuß (ausdauernd). Sie hatten sich in Vorstudien wegen ihres Biomasseertrags und Blühangebots als
vielversprechend herausgestellt. „Die Integration dieser heimischen Blühpflanzen in mehrjährige Anbausysteme zur Biomasseerzeugung für die energetische Verwertung könnte sich positiv auf
Artenvielfalt und die Resilienz in nachhaltigen Agrarsystemen auswirken“, erläutert Dr. Moritz von Cossel, leitender Wissenschaftler der Studie von der Universität Hohenheim.
Die Ergebnisse der neuen Studie bestätigen nun, dass dies eine gute Auswahl war: Die Wildpflanzen zeigten im Vergleich zu reinem Miscanthus bessere Verbrennungseigenschaften und ein besseres
Ascheschmelzverhalten auf – und das bei ähnlich hohen Heizwerten von 16,3-17,5 Megajoule pro Kilogramm (MJ/kg). Zum Vergleich: Holzpellets haben einen Wert um die 18 MJ/kg.
Höhere Effizienz, geringere Kosten bei der Verbrennung mit Wildpflanzen-Beimischung
Das Ascheschmelzverhalten zeigt an, bei welchen Temperaturen in einem Ofen die Asche eines Brennstoffs zu schmelzen beginnt und dadurch Schlacken entstehen, die sich ablagern und die Effizienz des
Ofens beeinträchtigen. „Die Studie bringt den Nachweis, dass ab einer Beimischung von 30 Prozent Wildpflanzen zur Miscanthus-Biomasse die Ascheschmelztemperatur um 20 Prozent von 1.000 auf
1.200 Grad Celsius signifikant erhöht ist“, erläutert Dr. Nicolai David Jablonowski, Ko-Autor der Studie vom Institut für Pflanzenwissenschaften am Forschungszentrum Jülich. „Die Mischung von
Wildpflanzen und Miscanthus verbessert also die Verbrennungsqualität. Das führt zu einer Effizienzsteigerung und einer Kostenreduzierung im Betrieb der Anlage“.
Das bessere Ascheschmelzverhalten erklärt sich aus der unterschiedlichen biochemischen Zusammensetzung von Miscanthus und den Wildpflanzen: Letztere enthalten höhere Anteile von Kalzium und
Magnesium – diese bilden bei der Verbrennung Mischphasen mit Miscanthus-Aschebestandteilen, was zu einer höheren Schmelztemperatur führt als bei reiner Miscanthus-Asche. Durch die
schrittweise Erhöhung der Wildpflanzen-Biomasse konnten in dieser Studie wichtige Hinweise auf eine ideale Zusammensetzung jedes Gemischs im Hinblick auf Brennwert, Ascheschmelzverhalten und
Verschlackung gefunden werden.
In einem nächsten Schritt könnten Langzeitstudien zeigen, ob der gemeinsame Anbau von Miscanthus und Wildpflanzen in größerem Umfang nicht nur zu einer größeren Artenvielfalt in der
Landwirtschaft führt, sondern im Sinne einer ganzheitlich nachhaltigen Bioökonomie auch rein wirtschaftlich Sinn macht. Die Einsparungen bei den Kosten der Verbrennung müssten dazu größer sein als
das, was an Einnahmen durch die geringeren Erträge bei der Wildpflanzen-Biomasse verloren geht. Dies hängt stark von den jeweiligen Standortbedingungen ab.
Originalveröffentlichung:
M. von Cossel, F. Lebendig, M. Müller, C. Hieber, Y. Iqbal, J. Cohnen, N.D. Jablonowski, Improving combustion quality of Miscanthus by adding biomass from perennial flower-rich wild plant
species, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 168, 2022, 112814, ISSN 1364-0321, https://doi.org/10.1016/j.
Nordamerikanische Vögel folgen wandelndem Klima nur teilweise
Klima-Entkopplung bei Lebensraumspezialisten besonders ausgeprägt
17.07.2022
Manche nordamerikanischen Vogelarten leben zunehmend an Orten, die nicht ihren bevorzugten klimatischen Bedingungen entsprechen. Dieses Phänomen der Klima-Entkopplung ist besonders ausgeprägt bei solchen Arten, die auf bestimmte Lebensräume spezialisiert sind. Obwohl das Klima nun anderorts günstigster für sie sein mag, verharren diese Tiere teilweise in ihren angestammten Lebensräumen. Dies sind die Ergebnisse einer Studie des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig, der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Biologischen Station Doñana, die jetzt in der Fachzeitschrift Nature Ecology & Evolution veröffentlicht worden ist. Die bei einem Viertel der untersuchten Vogelarten festgestellte Klima-Entkopplung kann diese Arten zusätzlich belasten und Bestandsrückgange verstärken.
Wenn die für eine bestimmte Art klimatisch geeigneten Orte einerseits und ihre tatsächliche Verbreitung und Häufigkeit andererseits zunehmend auseinanderklaffen, spricht man von Klima-Entkopplung. So lebt beispielsweise die Heuschreckenammer (Ammodramus savannarum) im nordamerikanischen Grasland, einem Lebensraum, der zunehmend verloren geht. Die hohe Spezialisierung der Heuschreckenammer in Verbindung mit dem Verlust intakter Lebensräume schränkt diese Art beim Einstellen auf ihre klimatische Nische stark ein. Das äußerst sich in starken Bestandsrückgängen und dem lokalen Aussterben der einst weit verbreiteten Art.
Ein Forscherteam unter der Leitung von iDiv, der Universität Leipzig und der MLU hat die besten verfügbaren Daten über die zeitliche Entwicklung von Vogelpopulationen aus dem North American Breeding Bird Survey (BBS) ausgewertet und festgestellt, dass mindestens 30 der 114 untersuchten nordamerikanischen Vogelarten (26 %) in den vergangenen 30 Jahren dem sich wandelnden Klima nur teilweise gefolgt sind. Das bedeutet, dass sich ihre Verbreitung und ihre Häufigkeit im Laufe der Zeit zunehmend vom lokalen Klima entkoppelt haben. Die Gründe dafür können für jede Art unterschiedlich sein. Einige neigen vielleicht dazu, in Gebieten zu bleiben, in denen sie schon immer gelebt haben, andere könnten in ihrer Verbreitung und Häufigkeit durch klimaunabhängige Ressourcen und Lebensräume eingeschränkt sein. Weitere könnten aufgrund globaler Veränderungen bereits so im Rückgang begriffen sein, dass sie sich nicht mehr auf wandelnde Klimabedingungen einstellen können. Bei 11 von 114 der untersuchten Arten (ca. 10 %) gab es hingegen einen gegenläufigen Trend – eine Klima-Kopplung. Die Verbreitung und Häufigkeit dieser Arten stimmten also mit ihren klimatisch bevorzugten Bedingungen zunehmend überein. Bei den übrigen Arten fanden sich weniger Anhaltspunkte für Klima-Kopplung oder Klima-Entkopplung – d. h. die Passgenauigkeit von Verbreitung und Häufigkeit einerseits und artspezifischem Klimaoptimum andererseits blieb stabil.
„Ein Ergebnis hat uns besonders überrascht: Der allgemeine Trend der Klima-Entkopplung hat sich anscheinend nicht verlangsamt“, sagt der Erstautor Dr. Duarte Viana, der den Großteil der Studie während seiner Anstellung bei iDiv und der Universität Leipzig durchführte und jetzt an der Biologischen Station Doñana in Sevilla arbeitet. „Dies deutet auf eine mögliche Rückkopplung zwischen der Klima-Entkopplung und dem Rückgang der Populationen hin, die sich angesichts zahlreicher globaler Veränderungen ergeben könnte“, fügt er hinzu.
Die Forscher konnten zeigen, dass die Klima-Entkopplung bei Lebensraumspezialisten stärker ausgeprägt war als bei Generalisten. Diese Spezialisten haben möglicherweise größere Schwierigkeiten in
zunehmend veränderten Landschaften die richtigen Kombinationen aus geeigneten Lebensräumen und Klimabedingungen zu finden.
„Wir haben auch festgestellt, dass die Klima-Entkopplung bei Arten, die als bedroht gelten und deren Populationsgröße abnimmt, stärker ausgeprägt ist“, sagt Senior-Autor Prof. Dr. Jonathan Chase, Leiter der Forschungsgruppe Biodiversitätssynthese bei iDiv und an der MLU. „Es gibt viele bekannte Faktoren, die zum Rückgang der Populationen vieler Vogelarten beitragen, aber unsere Studie fügt unserem Verständnis der möglichen Ursachen für einige dieser Veränderungen eine neue Facette hinzu – dass nämlich die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass die Arten unter ihren optimalen Klimabedingungen leben, während sich die Welt um sie herum verändert. Wie beim sprichwörtlichen Kanarienvogel in der Kohlemine sollten wir Menschen diese Veränderungen als Warnung verstehen, dass wir wahrscheinlich bald in ähnlicher Weise an Orten leben werden, die außerhalb unserer optimalen Klimaspanne liegen.“
Originalveröffentlichung:
(Forscher mit iDiv-Affiliation und Alumni fett gesetzt)
Viana, S. D., Chase, J. (2022): Increasing climatic decoupling of bird abundances and distributions. Nature Ecology & Evolution. DOI: 10.1038/s41559-022-01814-y
Erbguterfassung wildlebender Schimpansen – Neue Analysemethoden ermöglichen Einblicke in die Evolution von Schimpansen
02.06.2022
Den größten genetischen Katalog wildlebender Schimpansenpopulationen in Afrika hat ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des Instituts für Evolutionsbiologie (IBE), des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie (MPI-EVA) und der Universität Leipzig erstellt. Erstmals wurden die genetischen Informationen aus Hunderten von Kotproben aus dem gesamten Verbreitungsgebiet der Tiere sequenziert. Dieser Katalog, der in der Fachzeitschrift Cell Genomics veröffentlicht wurde, trägt maßgeblich zur Klärung der Evolutionsgeschichte dieser Menschenaffen bei. Darüber hinaus kann er helfen, Routen und Quellen des illegalen Handels zu kartieren, die zum Schutz dieser bedrohten Art genutzt werden können.
Im Gegensatz zum Menschen sind archäologische Funde der Vorfahren von Schimpansen kaum erhalten oder in Aufzeichnungen festgehalten worden. Fossilien von Schimpansen fehlen fast ganz. Entsprechend
sind die genetischen Informationen der heutigen Populationen die wesentliche Grundlage für die Beschreibung ihrer Evolutionsgeschichte und ihrer genetischen Vielfalt sowie für ihren Schutz.
Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des IBE in Barcelona zusammen mit iDiv, MPI-EVA und der Universität Leipzig, hat nun den bisher umfangreichsten Katalog der genetischen Vielfalt
von Populationen wildlebender Schimpansen erstellt. Genetische Informationen wurden Hunderten von Schimpansen-Kotproben entnommen. Erstmals wurden für die Auswertung Methoden zur Analyse alter DNA
angewandt.
Der erste Genomatlas für Schimpansen aus nicht-invasiven Proben
„Um aus den Kotproben genetische Informationen zu gewinnen, nutzten wir erstmals Methoden, die ursprünglich für die Untersuchung alter DNA, etwa der der Neanderthaler, entwickelt wurden. Wir haben diesen Ansatz auf eine noch nie dagewesene Anzahl von Schimpansenproben aus dem Feld angewandt“, betont Prof. Tomàs Marquès-Bonet, leitender Forscher des IBE und Letztautor der Studie.
Rekonstruktion der Evolutionsgeschichte der Schimpansen als Beitrag für Ihren Schutz
Mit diesem umfangreichen Datensatz bringen die Autoren Licht in die demografische Vergangenheit der Schimpansen und liefern weitere Beweise für die genetische Differenzierung der vier anerkannten Unterarten und den Austausch zwischen ihnen.
So stellte das Forschungsteam fest, dass geografische Faktoren wie Flüsse Barrieren für den Genfluss zwischen Schimpansenunterarten oder -gemeinschaften darstellen. Darüber hinaus zeigen die Autorinnen und Autoren potentielle Muster für die Wanderung, Vernetzung und Isolation zwischen Schimpansengruppen auf, die die genetischen Variationen dieser Populationen in den letzten 100.000 Jahren geprägt haben.
„Unser Ansatz ist sehr hilfreich bei der Ermittlung von Barrieren und natürlichen Korridoren zwischen Populationen. Damit können wir wertvolle Informationen zum Schutz der Tiere liefern“, sagt Dr. Clàudia Fontserè hinzu, Forscherin der IBE-Gruppe für vergleichende Genomik und Erstautorin der Studie.
„Wie wir Menschen haben auch Schimpansen eine komplexe Evolution hinter sich. Ihre Dynamik und die Gebiete, in denen frühere und heutige Kontakte zwischen Populationen bestehen, müssen eindeutig identifiziert werden, um zum Schutz dieser gefährdeten Art beizutragen“, betont Dr. Mimi Arandjelovic, Forscherin am iDiv, MPI EVA und der Universität Leipzig. Arandjelovic ist ebenfalls Letztautorin der Studie und Co-Direktorin des Pan African Programme: The Cultured Chimpanzee (PanAf), eines Konsortiums von Forscherinnen und Naturschützern von Schimpansen aus Afrika, Europa und Nordamerika.
Genetik im Kampf gegen den illegalen Handel
Mit Hilfe der neuentwickelten Gendatenbank konnte das Team zuverlässig den Herkunftsort der Tiere bestimmen, was bisher nicht möglich war. Die Methode kann aber auch direkt für den Schutz von Schimpansen eingesetzt werden, etwa um illegale Handelsrouten für Wildtierprodukte und Waisenkinder zu identifizieren. „Beschlagnahmte Schimpansen stammen in der Regel von Orten, die nur wenige hundert Kilometer von der Fundstelle entfernt sind. Die genetische Auswertung der Kotproben kann so zuverlässige Informationen darüber liefern, welche Regionen vorrangig geschützt werden sollten“, fügt Marquès-Bonet hinzu. Die entwickelte Methodik wird bereits bei Schutzprojekten für andere Primaten- und Säugetierarten angewendet.
(Basierend auf einer Medienmitteilung des Instituts für Evolutionsbiologie (IBE), Barcelona)
Originalpublikation:
Fontserè, C., …, Junker, J., …, Kühl, H. S., …, Arandjelovic, M., Marquès-Bonet, T. (2022): Population dynamics and genetic connectivity in recent chimpanzee history. Cell Genomics. DOI: 10.1016/j.xgen.2022.100133
|
Fotos von Amazonastieren liefern umfangreiche Daten zur Artenvielfalt Ein internationales Forschendenteam hat die größte Datensammlung aus Kamerafallen über Tiere des Amazonas-Regenwaldes veröffentlicht. Die Sammlung umfasst derzeit über 120.000 Datensätze mit Zeit- und Ortinformationen. Sie wird die Forschung über den Bestand, die Vielfalt und die Lebensraumbedingungen von Jaguaren, Tukanen, Harpyien und vielen anderen gefährdeten Regenwaldarten verbessern und zu deren Schutz beitragen. 147 Wissenschaftler aus 122 Forschungseinrichtungen und Naturschutzorganisationen arbeiteten unter der Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena zusammen, um diese neue Datenbank aufzubauen, die auf Kamerafallenfotos basiert. Sie wurde jetzt in der Zeitschrift Ecology veröffentlicht.
Ein internationales Forscherteam hat nun erstmals Daten von zahlreichen Kamerafallenstudien aus verschiedenen Regionen des Amazonas zusammengestellt. Das Ergebnis ist die bisher umfassendste Datenbank zu Säugetier-, Vogel- und Reptilienarten in dieser Region. Insgesamt wurden 120.849 Datensätze zu 289 Arten aus den Jahren 2001 bis 2020 gesammelt und vereinheitlicht. Die Daten liefern Informationen aus 143 Untersuchungsgebieten im gesamten Amazonasbecken – einem Gebiet von fast 8,5 Millionen Quadratkilometern, das sich über die Staaten Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Französisch-Guayana, Peru, Surinam und Venezuela erstreckt.
„Unsere Datenbank verbessert die Informationslage über Wirbeltiere im Amazonasgebiet erheblich“, sagt Ana Carolina Antunes, Doktorandin an der Universität Jena und Mitglied der iDiv-Forschungsgruppe Biodiversitätstheorie. Bisher war das Wissen über die Anzahl, die Vielfalt, die Verbreitungsmuster und das Verhalten der Arten in diesem Gebiet sehr lückenhaft und daher spärlich. Die Informationen waren über viele Einzelveröffentlichungen, graue Literatur und unveröffentlichte Rohdaten verstreut. Diese Datenbank ermöglicht nun groß angelegte Analysen der zeitlichen und räumlichen Veränderungen der Populationsdichten und der Aufenthaltsmuster der Tiere.
„Mit den Kameras kann man nicht nur schöne Fotos von den Tieren machen. Sie liefern auch weitere wichtige Daten, aus denen sich ableiten lässt, wie sich der Klimawandel und die vom Menschen verursachten Landschaftsveränderungen auf Tiere und ihre Lebensräume in großem Maßstab auswirken. Dieses Wissen kann helfen, Schutzmaßnahmen für Tierarten zu entwickeln, die durch diese Veränderungen besonders bedroht sind“, sagt Antunes. So kann die Datenbank dazu beitragen, den Jaguar im Amazonaswald zu schützen, indem sie genauere Lebensraumanalysen liefert: Aussagen darüber, welche Lebensräume den Bedürfnissen des Jaguars am besten entsprechen und welche nicht. Die Ergebnisse der Analysen können für die Kartierung und Ausweisung von Schutzgebieten genutzt werden. Sie bestätigen auch die Bedeutung der bereits ausgewiesenen Schutzgebiete für den Jaguar und seine Beutetiere.
Die bisher fragmentierten Daten, die nur kleinere Gebiete abdeckten, erlaubten nur sehr spärliche Aussagen über die großräumigen Lebensräume, die Jaguare benötigen. Die Datenbank verbessert auch die Möglichkeiten zum Vergleich der Populationsdichten zwischen geschützten und nicht geschützten Gebieten. Und was die Datenanalyse für den Schutz des Jaguars ermöglicht, gilt natürlich auch für Ozelots, Tapire, Pekaris und viele mehr.
Die Amazonas-Kamerafallen-Datenbank ist Teil der „Amazonas-Datenreihe“, einer Initiative, die 2017 mit der „Atlantik-Reihe“, der „Brasilien-Reihe“ und der „Neotropischen Reihe“ gestartet wurde und von Milton Ribeiro und Mauro Galetti von der Staatlichen Universität São Paulo (UNESP) in Brasilien geleitet wird. Ribeiro, der auch Senior-Autor dieser Studie ist, fügt hinzu: „Insgesamt ermöglichen uns diese Daten, unser Potenzial zur Beantwortung wichtiger Fragen im Zusammenhang mit der Erhaltung und der Entwicklung der öffentlichen Politik zu erweitern“ (Urs Moesenfechtel)
Originalpublikation: Antunes, A. C., Galetti, M., Ribeiro, M. C. et al. (2022): AMAZONIA CAMTRAP: A dataset of mammal, bird, and reptile species recorded with camera traps in the Amazon forest. Ecology. DOI: 10.1002/ecy.3738 |
||||
Seltene Beobachtung zweier erwachsener Jaguare (Panthera onca) bei der gemeinsamen Nahrungssuche, wahrscheinlich während der Brutzeit in den Várzea-Auenwäldern des Mamirauá Sustainable Development Reserve (MSDR), Zentralamazonien (Bild: www.mamiraua.org)
Nur wenige Schmetterlinge mögen das Stadtleben
Forscher erfassen Anpassungsfähigkeit von 158 Falterarten an die Urbanisierung
31.05.2021
Halle/Jena/Leipzig. Die sich stark ausbreitenden städtischen Lebensräume dürften auf lange Sicht einen Großteil von Schmetterlingsarten gefährden. Das vermelden Forschende vom Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU) in der Fachzeitschrift Global Change Biology. Nur Generalisten, die große Temperaturschwankungen tolerieren und sich von vielen verschiedenen Pflanzen ernähren, profitieren voraussichtlich von den menschlich geprägten Lebensräumen. Die Autoren empfehlen, zur Erhaltung der Artenvielfalt die Bedürfnisse von spezialisierten Schmetterlingsarten in der Städte- und Raumplanung zu berücksichtigen.
Die Veränderung von Lebensräumen, etwa durch Urbanisierung, ist eine der wichtigsten Ursachen für den Rückgang der biologischen Vielfalt. Weltweit wird bis 2050 ein Zuwachs der Siedlungen und Städte von 2 - 3 Millionen Quadratkilometern – etwa der Hälfte der Fläche von Grönland – prognostiziert. Natürliche und naturnahe Lebensräume werden so nach und nach durch urbane Lebensräume mit völlig neuen Bedingungen ersetzt.
Wie die Wildtiere sich auf solch fundamentale Veränderungen einstellen können, istvorwiegend nur für wenige Artengruppen wie etwa Säugetiere und Vögel untersucht. „Um jedoch Vorhersagen zur Entwicklung der biologischen Vielfalt als Ganzes machen und aktuelle Phänomene wie das Insektensterben bekämpfen zu können, braucht es gesichertes Wissen auch für andere Artengruppen“, sagt Erstautor der Publikation Dr. Corey Callaghan, Postdoktorand am iDiv und an der MLU. Allerdings sei die Datengrundlage hier wesentlich schlechter. „Schmetterlinge bieten jedoch den Vorteil, dass sie beliebt bei vielen Menschen sind, die ehrenamtlich deren Vorkommen erfassen, was eine verhältnismäßig gute Datengrundlage schafft.“
Großteil der Schmetterlinge durch Urbanisierung gefährdet
Um herauszufinden, wie Schmetterlinge auf die zunehmende Urbanisierung reagieren und welche Arten sich daran anpassen können, werteten die Wissenschaftler über 900.000 Einträge zu 158 Schmetterlingsarten in Europa aus der Global Biodiversity Information Facility (GBIF) aus. Dabei handelt es sich um das größte frei zugängliche Portal für Biodiversitätsdaten zu allen Arten, in das auch viele ehrenamtliche Daten einfließen.
Die Verbreitungsdaten zeigten, dass die Mehrheit (79 %) der Schmetterlingsarten die Städte meidet. Immerhin 25 der 158 Arten kamen im städtischen Umfeld häufiger vor als in anderen Lebensräumen, allen voran der Gelbe C-Falter (Polygonia egea). Die geringste Affinität zum Stadtleben zeigte der Kleine Maivogel (Euphydryas maturna). „Überraschend war, dass wir so klare Muster über den gesamten europäischen Kontinent hinweg gefunden haben“, sagt Callaghan. „Der Grad der Stadtaffinität deutet darauf hin, welche Arten künftig voraussichtlich zu den Gewinnern und Verlierern der Urbanisierung gehören.“
Generalisten sind Gewinner, Spezialisten Verlierer des Städtebaus
Zudem untersuchten die Forscher, welche Merkmale solchen Arten ihre Stadtaffinität verliehen. Es stellte sich heraus, dass vor allem Generalisten sich gut an den städtischen Lebensraum anpassen können, also solche Arten, die sich von vielen verschiedenen Pflanzen ernähren und starke Temperaturschwankungen aushalten können. Außerdem war den Gewinnern gemein, dass sie grundsätzlich mehr Zeit des Jahres Flugaktivität zeigten und sich mehrmals im Jahr fortpflanzten. Spezialisierte Arten hingegen, die stark von einer bestimmten Pflanze oder Pflanzengemeinschaft und Klimabedingungen abhängen, dürften künftig im städtischen Umfeld nicht so gut zurecht kommen.
„Mit unserer Methode konnten wir zeigen, dass sich Artmerkmale wie Temperatur- und Lebensraumpräferenzen gut als Anhaltspunkte nutzen lassen, um vorherzusagen, welche Arten am empfindlichsten auf menschliche Aktivitäten reagieren, um sie bei Schutzmaßnahmen zu priorisieren“, sagt Mitautorin Dr. Diana Bowler vom iDiv und der FSU.
Bedürfnisse von Spezialisten in Planung berücksichtigen
Um den Verlust der Artenvielfalt durch Urbanisierung aufzuhalten, sehen es die Autoren als notwendig an, dass Stadt- und Regionalplaner künftig das Vorkommen von Nahrungsarten und Wirtspflanzen besonders von spezialisierten Schmetterlingen sicherstellen. „Jeder Gartenbesitzer kann aber auch selbst mithelfen, indem er heimische Pflanzen wählt,” meint Callaghan.
„Unsere Arbeit veranschaulicht die Kraft der Bürgerwissenschaft und Datenportalen wie GBIF,”, sagt Letztautor Prof. Dr. Henrique Pereira vom iDiv und der MLU. „Die meisten der von uns verwendeten Schmetterlingsbeobachtungen aus der GBIF-Datenbank wurden von Freiwilligen in ganz Europa zusammengetragen. Jeder kann dazu beitragen, das Wissen über die Auswirkungen unserer Lebensweise auf die biologische Vielfalt zu vergrößern.” Ein sehr einfacher Weg sei es, Smartphone-Apps wie iNaturalist oder naturgucker zu nutzen. Diese speisen ihre Daten direkt in die GBIF-Datenbank ein und stellen sie Wissenschaftlern weltweit zur Verfügung, um besser zu verstehen, wie es der biologischen Vielfalt auf unserem immer stärker veränderten Planeten geht.
Diese Forschungsarbeit wurde gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; FZT-118).
Sebastian Tilch
Originalpublikation:
(Forscher mit iDiv-Affiliation fett)
Callaghan, C. T., Bowler, D. E., Pereira, H. M. (2021): Thermal flexibility and a generalist life history promote urban affinity in butterflies. Global Change Biology, DOI: 10.1111/gcb.15670
Ansprechpartner: |
| Dr. Corey Callaghan (spricht Englisch) Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle - Jena - Leipzig Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) E-Mail: corey.callaghan@idiv.de |
Braune Hundezecke gesucht:
Uni Hohenheim bittet Hundehalter erneut um Mithilfe
Eingeschleppte Braune Hundezecke liebt warmes Klima und Wohnungen / Forscherin bittet wieder um Zusendung auffälliger Zecken / alle Infos: https://hundezecken.
Hundehalter aufgepasst: Die eigentlich in Nordafrika heimische Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus) scheint sich auch in Deutschland wohl zu fühlen – vor allem in Wohnungen mit
Hunden, wo sie schnell zur Plage werden kann. Hundebesitzerinnen und -besitzer sollten deshalb darauf achten, dass ihr vierbeiniger Gefährte aus dem Urlaub keine unerwünschten „Souvenirs“ mit nach
Hause bringt. Denn inzwischen ist die Braune Hundezecke auch im Mittelmeerraum und der Schweiz zu finden, sogar aus den Niederlanden wurde über erste Funde berichtet. So kann sie immer mal wieder
nach Deutschland eingeschleppt werden. Um mehr über die Zecke und ihre Verbreitung zu erfahren, bitten die Zeckenexpertinnen der Universität Hohenheim in Stuttgart auch dieses Jahr wieder darum,
Funde der Braunen Hundezecke mit Bild zu melden. Alle Informationen unter: https://hundezecken.
Sie reist wohl aus dem Urlaub mit nach Deutschland, vermutet Prof. Dr. Ute Mackenstedt, Parasitologin und Expertin für Zecken an der Universität Hohenheim: „Wir gehen davon aus, dass die Braune
Hundezecke mit Hunden, die mit ihren Haltern im Auslandsurlaub waren, nach Deutschland kommt. Es wurden aber auch bereits Exemplare an Hunden gefunden, die ihren Hof nie verlassen hatten – ein
Hinweis darauf, dass die Art hier möglicherweise bereits Fuß gefasst hat.“
Zwar wurden in dieser Zeckenart bisher keine FSME- oder Borreliose-Erreger festgestellt, sie kann aber typische Hundekrankheiten aus dem Mittelmeerraum, wie Ehrlichiose und Babesiose übertragen.
„Obwohl der Hund ihr bevorzugter Wirt ist, werden auch gelegentlich Menschen gestochen. Wenn sie eine Blutmahlzeit benötigt, ist sie nicht wählerisch“, so Prof. Dr. Mackenstedt. „Auf diese Weise kann
die Braune Hundezecke unter Umständen auch die Erreger für das Mittelmeerfleckfieber weitergeben.“
Eine Braune Hundezecke kommt selten allein
Beim Hund verursacht der Stich einer einzelnen Braunen Hundezecke meist lediglich geringe Hautirritationen. Doch kommt eine Braune Hundezecke selten allein. Häufig sitzen mehrere bis viele dieser
Plagegeister sehr dicht nebeneinander, wenn sie ihre Blutmahlzeit aufnehmen.
„Dabei bevorzugen sie gut durchblutete Körperbereiche des Hundes mit dünner Haut, wie beispielsweise Ohren, Leisten, Achselhöhlen, der Rücken oder die Zehenzwischenräume“, erläutert Katrin Fachet,
Doktorandin im Fachgebiet Parasitologie.
Nicht jede Zecke auf dem Hund ist dabei jedoch automatisch die Braune Hundezecke, fügt Katrin Fachet hinzu. „Die Braune Hundezecke wird aus dem Mittelmeerraum durch Ihren Hund nach Deutschland
eingeführt. Dabei ist der Hund das Entscheidende.“
Wohnräume als idealer Lebensraum
Gelangen die Zecken mit dem Hund oder beispielsweise seinem Hundebett nach Deutschland, können sie, anders als unser Gemeiner Holzbock, sehr gut in Wohnungen überleben und sich dort sogar vermehren.
„Um die 25 Grad und trocken – so hat sie es am liebsten“, sagt Katrin Fachet. „Und wenn dann noch ein Hund in der Nähe ist, hat die Braune Hundezecke den idealen Lebensraum für sich gefunden.“
Hauptsächlich halten sich die Zecken an den Orten auf, an denen die Hunde die Nächte oder lange Ruhezeiten verbringen, wie zum Beispiel dem Hundebett oder in der Hundehütte. Nach einer Blutmahlzeit
verlassen sie ihren Wirt und ziehen sich in Spalten und Ritzen zurück. Dann findet man die Braune Hundezecke hinter Fußleisten, unter Dielen und hinter Tapeten oder in Natursteinwänden. In der
Wohnung kann die Braune Hundezecke so schnell zu einer sehr unangenehmen Plage werden. Um es gar nicht erst soweit kommen zu lassen, empfehlen die Expertinnen eine wirksame Zeckenprophylaxe. Der
Tierarzt kann hier beraten.
Aber auch bei einem Befall müsse man aber nicht gleich die Abrissbirne schwingen, betont Prof. Dr. Mackenstedt: „Es ist zwar nicht schön und mehr als ärgerlich, wenn die Braune Hundezecke sich in der
Wohnung eingenistet hat, aber man kann durchaus etwas dagegen tun, und gerne unterstützen wir dabei auch die Betroffenen.“
Forschung zur Braunen Hundezecke
Insgesamt ist jedoch noch wenig über die Braune Hundezecke bekannt. Wie gelangt die Zecke überhaupt nach Deutschland? Welche Krankheitserreger kann sie übertragen? Kann sie auch von Hund zu Hund
weitergegeben werden? Das sind Fragen, mit denen sich Wissenschaftlerinnen von der Universität Hohenheim seit zwei Jahren beschäftigen.
In ihrer Doktorarbeit konnte Katrin Fachet schon 21 Funde genauer analysieren: „Bei der Braunen Hundezecke interessiert uns unter anderem, ob sie aufgrund der veränderten Wetter- und Klimabedingungen
und den wärmeren Wintern auch außerhalb von Wohnungen überleben kann. Hierzu brauchen wir noch mehr Daten. Wir sind dankbar für jede eingesendete Braune Hundezecke, die wir im Labor erforschen
können.“
Parasitologie der Universität Hohenheim bittet Hundehalter wieder um Mithilfe
Deswegen bittet sie auch dieses Jahr wieder um die Mithilfe der Bevölkerung: „Sollten Sie häufiger eine ungewöhnliche Anzahl an braunen Zecken in einem Gebäude bemerken oder sollte Ihr Hund sehr
stark von Zecken befallen sein, die der Braunen Hundezecke ähnlich sehen, dann schicken Sie bitte eine E-Mail mit Foto, Datum und Fundort der Zecke an hundezecken@uni-hohenheim.de.“
Die Expertin wird sich dann schnellstmöglich beim Finder mit einer Einschätzung melden, ob es sich um eine Braune Hundezecke handeln könnte und ob es sinnvoll ist, den Fund auf dem Postweg an die
Universität Hohenheim einzuschicken.
„Schön wäre es, wenn die Zecke nicht mit Tesafilm oder anderen Klebstoffen in Berührung kommt. Denn für die eindeutige Zuordnung brauchen wir feine Härchen und Oberflächenstrukturen, die sich dann
nicht mehr erkennen lassen“, ist Katrin Fachet noch wichtig. „Deswegen gibt man die Zecken am besten in ein kleines, luftdichtes Gefäß, wie zum Beispiel einen Kunststoff-Cremetiegel, ein sehr kleines
Einmachglas oder Ähnliches.“ Weitere Informationen gibt es unter: https://hundezecken.uni-
HINTERGRUND: Das Hundezecken-Projekt
Schon seit vielen Jahren widmen sich die Parasitologinnen und Parasitologen der Universität Hohenheim der Erforschung verschiedener Zeckenarten. Dabei werden sie häufig von Tierheimen,
Veterinärmedizinern und Jägern unterstützt, denn manche Zeckenarten lassen sich nicht einfach in der Natur sammeln. So wie die Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus).
Diese Zecken sind nach bisherigem Stand in Deutschland nicht heimisch, werden aber regelmäßig aus dem Ausland – vor allem aus dem Mittelmeerraum – eingeführt. Sie sind an die Lebensräume von Menschen
angepasst und können in Wohnräumen überleben und sich vermehren. Obwohl der Hund ihr bevorzugter Wirt ist, werden auch gelegentlich Menschen gestochen. Dabei können sie Krankheiten wie das
Mittelmeer-Fleckfieber übertragen.
Im Hundezecken-Projekt soll das Vorkommen dieser Zeckenart in Deutschland untersucht werden. Die Mithilfe der Bevölkerung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Zusammenarbeit ist auch für sie
vorteilhaft: Die Zecken werden von Experten bestimmt und untersucht. Nur so können wirksame Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Ergebnisse werden den Einsendern natürlich mitgeteilt.
Weitere Informationen, Bild- und Videomaterial:
https://zecken.uni-hohenheim.
https://www.youtube.com/watch?
Kontakt für Medien:
Prof. Dr. Ute Mackenstedt, Universität Hohenheim, Fachgebiet Parasitologie,
T +49 (0)711 459 22275, E Mackenstedt@uni-hohenheim.de
Katrin Fachet, Universität Hohenheim, Fachgebiet Parasitologie,
T +49 (0)711 459 23071, E fachet@uni-hohenheim.de
„Zugvögel helfen tatsächlich Pflanzen mit dem Klimawandel Schritt zu halten, aber eben nur einer Minderheit und nur bestimmten Arten. Dieser Filter wird die Bildung der neuen Pflanzengemeinschaften in nördlichen Gebieten stark beeinflussen und könnte in der neuen Heimat Ökosystemleistungen, wie zum Beispiel die Produktion von Pflanzenbiomasse und den Aufbau ökologischer Lebensgemeinschaften auf höheren Ebenen der Nahrungskette, beeinträchtigen. Zudem ist diese Form der Ausbreitung besonders an einzelne Vogelarten gebunden, von denen einige im Mittelmeerraum sowohl legal als auch illegal stark bejagt werden. Das macht den Transport störanfälliger als die Verbreitung durch viele Vogelarten“, kommentiert Albrecht die Ergebnisse.
Basiert auf einer Medienmitteilung der Wildlife Conservation Society
Liverpool/Leipzig/Halle.
Für die Primaten wird es eng
Forscher prognostizieren massiven Rückgang des Verbreitungsgebiets afrikanischer Menschenaffen in den nächsten 30 Jahren
07.07.2021
Der Klimawandel wird in den nächsten 30 Jahren das Verbreitungsgebiet afrikanischer Menschenaffen drastisch einschränken. Dies hat ein internationales Forscherteam unter Beteiligung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie (MPI EVA) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) prognostiziert. In verschiedenen Modellen berechneten sie die Auswirkungen von Klimawandel, Landnutzung und menschlichem Bevölkerungswachstum auf das künftige Verbreitungsgebiet von Gorillas, Schimpansen und Bonobos. Die bisherigen Schutzgebiete reichten nicht aus, um wichtige Populationen dauerhaft zu erhalten, warnen die Forscher in der Fachzeitschrift Diversity and Distributions. Die Studie floss auch in die ARD-Dokumentation „Planet ohne Affen“ ein, die heute ausgestrahlt wird.
Für ihre Analyse trugen die Autoren Informationen über das Vorkommen afrikanischer Menschenaffen zusammen, die in der A.P.E.S.-Datenbank der Weltnaturschutzunion (IUCN) gespeichert sind. Diese
Datenbank enthält eine einzigartige Menge an Informationen über den Zustand der Populationen, Bedrohungen und Schutzmaßnahmen für mehrere hundert Standorte, die über 20 Jahre hinweg gesammelt wurden
(http://apesportal.eva.mpg.de/
Die Forscher quantifizierten erstmals die Gesamtheit der Auswirkungen von Änderungen des Klimas, der Landnutzung und der Bevölkerungszahlen in den Verbreitungsgebieten der afrikanischen Menschenaffen für das Jahr 2050. Dabei berücksichtigten sie Best- und Worst-Case-Szenarien. „Best case bedeutet, dass die Kohlenstoff-Emissionen langsam zurückgehen und dass geeignete Maßnahmen zur Eindämmung ergriffen werden“, erklärt die Mitautorin der Publikation Jessica Junker, Postdoktorandin am iDiv und an der MLU. „Worst case geht davon aus, dass die Emissionen ungebremst weiter ansteigen – also business as usual.“
Unter dem Best-Case-Szenario sagen die Autoren voraus, dass Menschenaffen innerhalb der nächsten 30 Jahre 85 Prozent ihres Verbreitungsgebietes verlieren werden. Die Hälfte davon werde dabei außerhalb von Nationalparks und anderen gesetzlich geschützten Gebieten liegen. Unter dem Worst-Case-Szenario sagen sie einen Verlust von 94 Prozent voraus, wovon 61 Prozent auf nicht geschützte Gebiete entfielen.
Bisherige Schutzgebiete reichen nicht aus
Höher gelegene Gebiete sind für einige Menschenaffenarten derzeit weniger attraktiv – vor allem aufgrund des geringeren Nahrungsangebotes. Doch durch den Klimawandel verändert sich das. Tieflandgebiete werden wärmer und trockener, die Vegetation verschiebt sich nach oben. Wenn Populationen in der Lage sind, vom Tiefland in die Berge zu ziehen, könnten sie überleben und sogar ihr Verbreitungsgebiet vergrößern – je nach Art und je nachdem, ob das Best- und Worst-Case-Szenario eintritt. Es kann aber auch sein, dass sie nicht in der Lage sind, sich in der verbleibenden Zeit zwischen heute und 2050 aus dem Tiefland wegzubewegen.
„In dem wir zukünftige Klima- und Landnutzungsänderungen sowie menschliche Bevölkerungsszenarien eingebunden haben, können wir mit unserer Studie starke Beweise liefern, wie die wichtigsten globalen Einflussfaktoren als Gesamtheit künftig die Verbreitung von Menschenaffen in Afrika einschränken“, sagt Joana Carvalho, Postdoktorandin an der naturwissenschaftlichen Fakultät der Liverpool John Moores University und Erstautorin der Studie. „Dass die größten Verluste des Verbreitungsgebiets außerhalb von Schutzgebieten zu erwarten sind, zeigt deutlich, dass das derzeitige Netzwerk von Schutzgebieten in Afrika noch unzureichend ist, die Lebensräume für Menschenaffen zu erhalten und Menschenaffenpopulationen effektiv zu verbinden.“
Lebensräume müssen verbunden sein
Die Ergebnisse bestätigen andere aktuelle Studien, die zeigen, dass die afrikanischen Menschenaffenpopulationen und ihre Lebensräume dramatisch zurückgehen. Alle afrikanischen Menschenaffen sind auf der Roten Liste der bedrohten Arten der IUCN entweder als gefährdet (Berggorillas, Bonobos, Nigeria-Kamerun-Schimpansen, Östliche Schimpansen und Zentrale Schimpansen) oder als vom Aussterben bedroht (Cross-River-Gorillas, Grauer-Gorillas, Westliche Flachlandgorillas und Westliche Schimpansen) eingestuft.
Die Autoren argumentieren, dass effektive Erhaltungsstrategien für jede Art geplant und dabei bestehende als auch vorgeschlagene Schutzgebiete berücksichtigt werden müssten. Dabei könnten die Modelle zur Lebensraumeignung bei der Einrichtung und beim Management von Schutzgebieten helfen. Darüber hinaus wird es entscheidend für das Überleben der afrikanischen Menschenaffen sein, Verbindungen und Korridore zwischen den Lebensräumen zu erhalten und herzustellen, die als künftig geeignet vorhergesagt werden. Landnutzungsplanung und Maßnahmen zur Abschwächung des Klimawandels müssten dringend in die Regierungspolitik jener Länder eingebunden werden, in denen Menschenaffen leben.
Weltweiter Verbrauch natürlicher Ressourcen zu hoch
„Der weltweite Verbrauch natürlicher Ressourcen, die in den Verbreitungsgebieten der Menschenaffen abgebaut werden, ist eine der Hauptursachen für den Rückgang der Menschenaffen, sagt Letztautor Dr. Hjalmar Kühl vom iDiv und MPI EVA. Alle Nationen, die von diesen Ressourcen profitieren, stehen in der Verantwortung, eine bessere Zukunft für Menschenaffen, deren Lebensräume sowie für die darin lebenden Menschen zu gewährleisten, indem sie eine nachhaltigere Wirtschaft voranbringen.“
Preisgekrönte Doku in der ARD
Am 7. Juni um 20.15 Uhr zeigen die ARD in der Reihe „Erlebnis Erde“ die 90-minütige Doku „Planet ohne Affen“, in die auch Informationen aus der Studie eingeflossen sind. Der Film wurde bereits als „Bester Dokumentarfilm“ auf mehreren US-amerikanischen Filmfestivals ausgezeichnet.
Diese Forschungsarbeit wurde u.a. gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG; FZT-118).
Originalpublikation:
(Forscher mit iDiv-Affiliation fett)
Carvalho, J.S., … , Junker, J., … & Kühl, H.S. (2021): Predicting range shifts of African apes under global change scenarios. Diversity and Distributions, DOI: 10.1111/ddi.13358
Ansprechpartner: |
| Dr. Hjalmar Kühl Leiter der Forschungsgruppe "Nachhaltigkeit und Komplexität der Lebensräume von Menschenaffen" Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) Halle-Jena-Leipzig Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie (MPI-EVA |
|
|
<< Neues Textfeld >>
Globaler Atlas soll große Tierwanderungen bewahren
10.05.2021
Start einer globalen Initiative mit Beteiligung von Forschern der Uni Hohenheim / Ziel: Die großen Huftierwanderungen weltweit kartieren und erhalten
Die Wanderungen großer Säugetiere gehören zu den eindrucksvollsten Naturwundern. Es gibt sie nicht nur in Afrika, sondern weltweit, auch in Europa. „Doch diese Wanderungen verschwinden in
alarmierendem Tempo“, berichtet Dr. Joseph Ogutu von der Universität Hohenheim in Stuttgart. „Um sie effektiv schützen zu können, müssen wir sie zunächst einmal erfassen und detailliert kartieren.“
Mit dem Ziel, einen weltweiten Atlas zu Tierwanderungen zu erstellen, hat er sich jetzt mit über 90 Forschenden aus aller Welt zusammengetan. Gemeinsam haben sie eine neue Initiative zum Schutz von
Huftierwanderungen gestartet, die Global Initiative for Ungulate Migration (GIUM). Einzelheiten dazu sind jetzt im renommierten Wissenschaftsmagazin Science nachzulesen: https://doi.org/
Die großen Wanderungen von Wildtieren gehören zu den beeindruckendsten Phänomenen in der Natur. Leider sind viele dieser erstaunlichen Schauspiele durch Eingriffe des Menschen bedroht. Der Verlust
von Lebensraum durch Landwirtschaft sowie Wilderei und Barrieren wie Zäune, Straßen und Eisenbahnen haben die historischen Wanderrouten nach und nach unterbrochen und zu einem massiven Rückgang
vieler einst spektakulärer Wanderherden geführt. „So ist seit Mitte der 1970er Jahre die Gnu-Population in Kenia um über 70 Prozent zurückgegangen“, berichtet Dr. Ogutu, Biostatistiker am Fachgebiet
von Prof. Dr. Hans-Peter Piepho an der Universität Hohenheim. Er setzt sich seit vielen Jahren für dieses Thema ein und hat ihm einen Großteil seiner Karriere gewidmet. „Kenia und Tansania haben
bereits vier ihrer charakteristischen Massenwanderungen verloren. Ihr kompletter Verlust würde nicht nur zu einem starken Rückgang der Artenvielfalt führen, sondern auch den Tourismus und die lokalen
Lebensgrundlagen gefährden.“ Erschwerend kommt das exponentielle Wachstum der Bevölkerung hinzu. So lebten in Kenia im Jahr 1948 rund 5,4 Millionen Menschen. In den folgenden 70 Jahren stieg die
Bevölkerungszahl um 780 Prozent, im Jahr 2019 betrug sie 47,6 Millionen. Im Jahr 2050 wird sie voraussichtlich 95,5 Millionen erreicht haben. Um diese rasant wachsende Bevölkerung ernähren zu können,
haben Viehzucht und Landwirtschaft des Landes in den letzten Jahren sprunghaft zugenommen.
Zäune als Todesfallen
Vor allem die ungeplante Ausbreitung von Zäunen hält Dr. Ogutu für problematisch: „Bei dem Versuch, dieses Labyrinth zu durchqueren oder darüber zu springen, verfangen sich viele Tiere in den Drähten
oder werden sogar getötet.“ Straßen und Eisenbahnen, Öl- und Gaspipelines sowie Staudämme sind weitere Barrieren, die die traditionellen Wanderwege unterbrechen.
Eine zusätzliche Bedrohung ist der Klimawandel. Viele Huftiere richten ihre Wanderungen nach dem Pflanzenwachstum und wichtigen Wetterereignissen aus. Doch aufgrund der immer häufiger auftretenden
Dürreperioden wird es für sie zunehmend schwieriger, ihre Wanderungen darauf abzustimmen und ausreichend Futter zu finden.
Wanderungen weltweit in Gefahr
Auch in anderen Teilen der Welt wird die freie Bewegung von wandernden Herden durch Barrieren zunehmend eingeschränkt. So lebt in Europa der Rothirsch heute in einer Landschaft, die durch menschliche
Besiedelung geprägt ist und so seinen Lebensraum zerstückelt. Nur in abgelegenen Regionen in den Alpen kann er noch weitgehend ungehindert über die Gebirgsketten wandern und den saisonalen Zyklen des
Pflanzenangebots folgen. Um einige dieser negativen Auswirkungen auszugleichen, haben viele Regierungen Schutzgebiete eingerichtet. Für Dr. Ogutu besteht das grundlegende Problem jedoch darin, dass
diese Wildreservate und Nationalparks in der Regel nicht groß genug sind, um das gesamte Verbreitungsgebiet der wandernden Tiere schützen zu können. Aus Sicht der Forschenden müssen daher dringend
die Wanderrouten gesichert werden, um weitere Verluste zu verhindern. Dafür müssen zunächst die genauen Wege kartiert und die kritischsten Hindernisse identifiziert werden. Diese können anschließend
beseitigt und so die traditionellen Wanderrouten wiederhergestellt werden.
Neue Technologien, neue Entdeckungen
Dabei ermöglichen neue leistungsstarke Technologien über die Tracking-Daten der Tiere eine präzise Kartierung von Langstreckenwanderungen. Die Ergebnisse überraschen Wissenschaft und Öffentlichkeit
gleichermaßen. Denn sie zeigen, dass die Bewegungen von Huftieren auf der ganzen Welt vielfältiger und komplexer sind als bisher angenommen. Wichtig ist es auch, dass die Forscher nicht nur jede
Wanderung kartieren, sondern auch verstehen, was die Tiere dazu bringt, sich entlang der jeweiligen Route zu bewegen. Eine wichtige Erkenntnis ist beispielsweise, dass das Wanderverhalten bei einigen
Arten nicht angeboren ist, sondern eine Art Kultur darstellt, die erlernt und über Generationen weitergegeben werden muss.
Bessere Politik durch weltweiten Atlas für Tierwanderungen
Um die unterschiedlichen Bemühungen zum Erhalt der Wanderrouten zu koordinieren, haben mehr als 90 Forschende die „Global Initiative for Ungulate Migration“ (GIUM) ins Leben gerufen:
Wissenschaftler, Naturschützer und Wildtiermanager aus aller Welt wollen eine gemeinsame Wissensbasis schaffen, einen weltweiten Atlas für Tierwanderungen entwickeln sowie die Einführung neuer
Schutzmaßnahmen und -richtlinien fördern. Schon heute setzen sich viele Regierungen der Welt für den Erhalt der Artenvielfalt und der Wildtierbestände ein. Dafür benötigen sie verlässliche
Informationen. So könnten beim Neubau von Straßen, Zäunen und anderen Infrastrukturen bereits bei der Planung die Lebensräume festgelegt werden, die unbebaut bleiben sollten oder wo Straßenquerungen
beziehungsweise Pipelines für Wildtiere überbrückt oder untertunnelt werden sollen. Ein anderer Ansatzpunkt sind für Dr. Ogutu Landpacht-Programme, die private und kommunale Naturschutzgebiete mit
erheblichen Zahlungen unterstützen: „So können ihre Kosten ausgeglichen und die Menschen abgehalten werden, ihr Land aufzuteilen, Zäune zu errichten oder wilde Tiere illegal zu töten.“
Publikation:
Kauffman MJ, Cagnacci F, Chamaillé-Jammes S et al.: Mapping out a future for ungulate migrations, Science, 372, 566-569; DOI: 10.1126/science.abf0998
Weitere Informationen:
https://www.cms.int/gium
Neuer FSME-Höchststand 2020
11.03.2021
Das Krisenjahr Jahr 2020 hält einen weiteren dramatischen Rekord: Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mehr als 700 Menschen an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) erkrankt. Dies ist
der höchste Wert, seit die Erkrankung im Jahr 2001 meldepflichtig wurde. Dabei steht Baden-Württemberg in diesem Jahr wieder an der Spitze der Statistik in Deutschland. Ebenso wie dort zeigt sich
jedoch auch in den europäischen Nachbarländern kein einheitliches Bild: Während in den südlich angrenzenden Ländern Rekordzahlen gemeldet und neue Risikogebiete ausgewiesen wurden, ist in den
nördlichen Nachbarländern die Erkrankungshäufigkeit sogar zurückgegangen. Noch ist zwar nicht ganz klar, ob es sich bei den neusten Entwicklungen nur um einen kurzfristigen Trend handelt, aber auf
der heutigen Pressekonferenz der Universität Hohenheim in Stuttgart rechneten die drei Experten langfristig mit einer steigenden FSME-Gefahr ‒ auch außerhalb der bekannten Risikogebiete. Weitere
Infos, Bild- und Videomaterial auch auf https://zecken.uni-
Pünktlich mit den ersten warmen Sonnenstrahlen krabbeln im Frühjahr die Zecken wieder aus ihren Verstecken. Bei ihrer Nahrungssuche haben sie es auf das Blut anderer Tiere abgesehen. Allerdings sind
manche Zeckenarten nicht so wählerisch und befallen auch den Menschen. Dabei können sie Krankheiten wie beispielsweise die Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME), eine Form der Hirnhautentzündung,
übertragen.
Schon seit mehreren Jahren beobachten Fachleute in Deutschland eine Zunahme der FSME-Erkrankungen beim Menschen. So wurden 2018 insgesamt 583 Fälle gemeldet. Zwar traten 2019 nur 443 bekannte
Krankheitsfälle auf, aber 2020 wurde mit über 700 Fällen wieder ein trauriger Rekord erreicht. Dabei traten die meisten Erkrankungen nach wie vor im Süden Deutschlands auf.
Zweigeteiltes Land – Grenze auf Höhe der deutschen Mittelgebirge
„Auch die angrenzenden Nachbarländer Österreich, Schweiz und Tschechien weisen für letztes Jahr extrem hohe Fallzahlen aus“, so Prof. Dr. Gerhard Dobler, Leiter des Nationalen Konsiliarlabors für
Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr.
Auf Höhe der deutschen Mittelgebirge zieht sich quasi eine Grenze durch Mitteleuropa. Südlich dieser gedachten Linie sind im Jahr 2020 die FSME-Zahlen zum Teil dramatisch angestiegen, während
nördlich davon die Erkrankungshäufigkeit praktisch unverändert geblieben ist.
„So sind die Zahlen in Skandinavien, den baltischen Staaten und Polen nahezu konstant geblieben und in Schweden haben sie sogar abgenommen. Das heißt aber nicht, dass nicht auch im Norden Hotspots
auftreten können“, warnt Prof. Dr. Dobler. „So wurde 2019 das Emsland als erstes Gebiet in Niedersachsen zum Risikogebiet erklärt. Man kann dem FSME-Risiko in Deutschland praktisch nicht mehr
ausweichen. Nahezu überall muss mit Infektionen gerechnet werden.“
Der Experte sieht aber deshalb keinen Grund zur Panik: „Mit einer Impfung kann man sich gut schützen. Vor allem in den Risikogebieten könnten dadurch die Krankheitszahlen drastisch gesenkt werden,
denn leider sind in Deutschland schätzungsweise nur rund 20 Prozent der Bevölkerung geimpft, und die Tendenz ist eher stagnierend. Dabei wird die Impfung von den Krankenkassen bezahlt und ist gut
verträglich.“
Baden-Württemberg führt FSME-Statistik an – Anstieg vor allem in höheren Lagen
„In den Jahren 2018 und 2020 wurden die meisten FSME-Fälle in Baden-Württemberg gezählt, während im Jahr 2019 die meisten FSME-Fälle aus Bayern gemeldet wurden.“, berichtete Dr. Rainer Oehme
vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg. „Letztes Jahr sind hier 331 Menschen an FSME erkrankt. Das trägt natürlich auch zum deutlichen Anstieg der deutschlandweiten Fallzahlen bei.“
Mit Ausnahme des Stadtkreises Heilbronn sind in Baden-Württemberg nach wie vor alle Stadt- und Landkreise FSME-Risikogebiete. Doch nicht in allen Risikogebieten sind laut Dr. Oehme die Zahlen
angestiegen: „Betroffen sind vor allem Naturherde, die in höheren Lagen angesiedelt sind, während andere Naturherde nur wenige und manchmal sogar gar keine Fälle ausweisen.“
Zu einem besonderen Hotspot entwickle sich der Landkreis Ravensburg: „Bereits im Jahr 2018 traten dort 22 Fälle auf. Mit 21 Fällen blieb die Zahl im vergangenen Jahr auf einem hohen Niveau
stabil.“
Risiko nicht mehr lokal eingrenzbar
„Leider kennen wird die konkrete Ursache für diese Zahlen nicht“, bedauerte Prof. Dr. Ute Mackenstedt, Zeckenexpertin an der Universität Hohenheim. Zwar könne eine Erklärung in dem durch die
Corona-Pandemie veränderten Verhalten liegen: Die Menschen hielten sich häufiger draußen in der einheimischen Natur auf und besuchten dabei auch verstärkt FSME-Risikogebiete. Laut Prof. Dr.
Mackenstedt ist dies aber sicherlich nicht der einzige Grund für die steigenden Zahlen.
„Insgesamt ist das ganze Geschehen sehr komplex. Es gibt offensichtlich Entwicklungen, die zu Veränderungen im Übertragungszyklus führen“, erklärt sie die Problematik. Und noch sind sich die Experten
auch nicht sicher, ob es sich nur eine kurzfristige Entwicklung handelt oder sich gerade ein langfristiger Trend abzeichnet.
„Generell beobachten wir aber seit einigen Jahren, dass sich das Risiko nicht mehr lokal eingrenzen lässt. In einigen Hotspots bleibt das Krankheitsrisiko über Jahre hinweg unverändert, in anderen
Regionen nimmt es zu und wieder in anderen sogar ab. Dabei korreliert die Anzahl der Erkrankungen nicht zwangsläufig mit der Zeckenzahl“, weiß Prof. Dr. Mackenstedt.
Erster Fund einer Auwaldzecke mit FSME-Erregern in Sachsen
„Insgesamt beobachten wir überwiegend eine Wanderung der FSME von Ost nach West, aber wie man sieht, ist der Krankheitserreger ebenfalls in den nördlicheren Bundesländern auf dem Vormarsch. Eine
Rolle spielt dabei sicherlich auch der Klimawandel. So ist der gemeine Holzbock, Ixodes ricinus, jetzt nicht nur in den wärmeren Jahreszeiten, sondern auch im Winter aktiv“, erklärt sie
weiter.
Zudem breitet sich auch die Auwaldzecke, Dermacentor reticulatus, in Deutschland immer weiter aus. Sie ist grundsätzlich das ganze Jahr über aktiv. „Zwar befällt sie Menschen nicht so gern,
aber sie könnte durchaus eine Rolle bei der Ausbreitung des FSME-Erregers spielen“, so Prof. Dr. Mackenstedt. „Uns ist letztes Jahr zum ersten Mal eine Auwaldzecke aus Sachsen eingeschickt worden, in
der wir FSME-Viren nachweisen konnten.“
Tropenzecke Hyalomma breitet sich aus
Auch eine andere Zeckengattung breitet sich in Deutschland aus: Die tropische Hyalomma-Zecke ist eigentlich in Afrika, Asien und Südeuropa beheimatet und wurde vermutlich über Zugvögel eingeschleppt.
„Sie überträgt zwar keine FSME, aber in ihrem eigentlichen Verbreitungsgebiet überträgt Hyalomma verschiedene andere Krankheitserreger, die das so genannte Krim-Kongo Hämorrhagische Fieber, das
Arabisch Hämorrhagische Fieber und eine Form des Zecken-Fleckfiebers hervorrufen können“, so Prof. Dr. Ute Mackenstedt. „Bislang konnten wir in Deutschland zum Glück jedoch nur die Erreger des
Zecken-Fleckfiebers nachweisen.“
„Das Besondere an Hyalomma ist ihr Jagdverhalten“, beschreibt Prof. Dr. Mackenstedt weiter. „Anders als unsere heimischen Zecken wie der gemeine Holzbock klettert sie nicht an Gräsern oder Sträuchern
hoch und lässt sich von Wildtieren oder Wanderern abstreifen. Hyalomma jagt ihre Beute aktiv, erkennt Warmblüter auf Distanzen von bis zu 10 Metern und kann sie über mehrere 100 Meter
verfolgen.“
Erneuter Aufruf Zecken einzuschicken
Für Ihre Forschung bittet die Expertin auch dieses Jahr wieder die Bevölkerung um Mithilfe: „Sowohl bei der Hyalomma als auch zur Zeckenforschung in Deutschland im Allgemeinen gibt es noch viel
Forschungsbedarf.“
Festgesogene Zecken am besten mit Zeckenzange, Zeckenkarte oder Pinzette entfernen und in kleinen, festverschlossenen Behältern senden an:
Universität Hohenheim
Prof. Dr. Ute Mackenstedt
Fachgebiet für Parasitologie
Emil-Wolff-Straße 34
70599 Stuttgart
HINTERGRUND: Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME)
Die FSME-Erreger werden durch europäische Zecken wie den europäischen Holzbock, aber auch die Auwaldzecke übertragen. In den Risikogebieten liegt die Wahrscheinlichkeit einer FSME-Infektion nach
einem Zeckenstich bei 1:50 bis 1:100. Nach cirka 10 Tagen treten grippeähnliche Symptome auf. Bei rund einem Drittel der Patienten kommt es nach einer vorübergehenden Besserung zu einem erneuten
Fieberanstieg und einer zweiten Krankheitsphase.
Bei leichten Verläufen klagen die Patienten vorwiegend über starke Kopfschmerzen. Bei schwereren Verläufen sind auch Gehirn und Rückenmark beteiligt. Zu den Symptomen gehören Koordinationsstörungen,
Lähmungen, Sprach- und Sprechstörungen sowie Bewusstseinsstörungen und epileptische Anfälle. Für ca. 1 % der Patienten endet die Krankheit tödlich. Ist die Krankheit erst einmal ausgebrochen, können
nur die Symptome therapiert werden. Schützen kann eine Impfung.
HINTERGRUND: Tropenzecke Hyalomma
Die beiden Arten Hyalomma marginatum und Hyalomma rufipes stammen ursprünglich aus den Trocken- und Halbtrockengebieten Afrikas, Asiens und Südeuropas. Mit ihren gestreiften Beinen
sind sie eine auffällige Erscheinung und viel größer als der normale Holzbock. Im eurasischen Raum sind sie potentielle Überträger des Hämorrhagischen Krim-Kongo-Fiebers und des Arabisch
Hämorrhagischen Fiebers. Zudem können sie Rickettsien übertragen, die das Zecken-Fleckfieber auslösen. Dieser Erreger wurde auch als einziger in den nach Deutschland eingewanderten Zecken
nachgewiesen.
Erwachsene Zecken bevorzugen große Tiere als Wirte, auf die sie sich aktiv bis zu 100 Meter zu bewegen. Larven und Nymphen befallen vor allem Vögel und Kleinsäuger. Sie bleiben bis zu 28 Tage auf
ihrem Wirt und können so mit Zugvögeln nach Deutschland eingeschleppt werden.
HINTERGRUND zur Zeckenforschung
Um das Zeckenvorkommen zu erfassen, „beflaggt“ Prof. Dr. Mackenstedt mit ihrem Team die Grundstücke. Dabei ziehen die Forschenden weiße Stoffbahnen über Fläche und Büsche. Die Zecken wechseln auf
diese Zeckenfahnen und werden anschließend abgesammelt und gezählt. Im Labor werden die Zecken getötet und auf FSME-Erreger und weitere Erreger getestet.
Straßenbäume als Mittel gegen Depressionen
29.01.2021
Straßenbäume im direkten Lebensumfeld könnten das Risiko für Depressionen und den Bedarf an Antidepressiva in der Stadtbevölkerung reduzieren. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forschern des
Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Universität Leipzig (UL) und der Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU).
Straßenbäume in städtischen Wohngebieten zu pflanzen könnte demnach eine effektive und preiswerte naturbasierte Lösung sein, um psychische Krankheiten, den lokalen Klimawandel und den Verlust
biologischer Vielfalt zu bekämpfen. Laut den Wissenschaftlern sollten Stadtplaner, Gesundheitsexperten und Naturschützern diese Maßnahme öfter in Betracht ziehen. Die Studie ist in der Zeitschrift
Scientific Reports erschienen.
Depressionen sind seit längerem auf dem Vormarsch – insbesondere in städtischen Gebieten. Die aktuelle Pandemie verstärkt dieses Phänomen noch zusätzlich. Einen Einfluss auf das seelische
Wohlbefinden hat unter anderem das direkte Lebensumfeld. Frühere Studien haben gezeigt, dass Grünflächen sich hier positiv auswirken. Jedoch stützen sich die meisten dieser Studien auf
Selbsteinschätzungen von Befragten, was einen Vergleich und Verallgemeinerungen der Ergebnisse schwierig macht.
Ein interdisziplinäres Forschungsteam von UFZ, iDiv, UL und FSU hat für dieses Problem eine Lösung gefunden und einen objektiven Indikator genutzt: Die Zahl der Verschreibungen von Antidepressiva. Um herauszufinden, ob eine bestimmte Art von „alltäglichem“ Grün die psychische Gesundheit positiv beeinflussen könnte, wählten die Forscher ein in europäischen Städten sehr typisches Element der Stadtnatur: Straßenbäume. Dabei konzentrierten sie sich auf die Frage, wie sich die Anzahl und Art der Bäume und ihre Nähe zum Wohnort zur Anzahl der verschriebenen Antidepressiva verhielt.
Die Forscher setzten die Daten von fast 10.000 erwachsenen Einwohnern der Stadt Leipzig, die an der LIFE-Gesundheitsstudie der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig teilgenommen hatten, mit räumlich genauen Daten zu Straßenbäumen der Stadt Leipzig in Beziehung. So konnten die Forscher den Zusammenhang zwischen Antidepressiva-Verordnungen und der Anzahl der Straßenbäume in unterschiedlichen Entfernungen von den Wohnorten der Menschen ermitteln. Weitere für Depressionen bekannte Faktoren wie etwa Beschäftigungsstatus, Geschlecht, Alter und Körpergewicht wurden aus den Ergebnissen herausgerechnet.
Straßenbäume im Umkreis unter 100 Metern könnten das Risiko, an einer Depression zu erkranken, verringern
Die Forscher konnten zeigen, dass mehr Bäume in unmittelbarer Umgebung des Hauses (unter 100 Meter Entfernung) häufig mit einer geringeren Zahl von Antidepressiva-Verschreibungen einhergingen. Dieser Zusammenhang war besonders klar für sozial schwache Gruppen, die in Deutschland am gefährdetsten gelten, an Depressionen zu erkranken. Straßenbäume in Städten könnten also als einfache naturnahe Lösung für eine gute psychische Gesundheit dienen, schreiben die Forscher. Die verschiedenen Baumarten scheinen dabei keine signifikante Rolle zu spielen.
„Unser Ergebnis deutet darauf hin, dass Straßenbäume dazu beitragen können, die Lücke der gesundheitlichen Ungleichheit zu schließen“, sagt die Hauptautorin der Studie Dr. Melissa Marselle. „Das ist eine gute Nachricht, da Straßenbäume relativ leicht zugänglich sind, und ihre Zahl ohne großen planerischen Aufwand erhöht werden kann.“ Als Umweltpsychologin führte sie die Forschung am UFZ und am iDiv durch und ist nun an der De Montford University in Leicester, Großbritannien, tätig. Marselle hofft, dass die Forschungsergebnisse „Gemeinderäte und städtische Behörden dazu veranlassen, Straßenbäume in städtischen Gebieten zu pflanzen, um die psychische Gesundheit zu verbessern und soziale Ungleichheiten zu verringern“. Straßenbäume sollten laut Marselle gleichmäßig in Wohngebieten gepflanzt werden, um sicherzustellen, dass diejenigen, die sozial benachteiligt sind, den gleichen Zugang haben, um von den gesundheitlichen Vorteilen zu profitieren.
Originalpublikation:
(Wissenschaftler mit iDiv-Affiliation fett)
Melissa R. Marselle, Diana Bowler, Jan Watzema, David Eichenberg, Toralf Kirsten & Aletta Bonn (2020): Urban street tree biodiversity and antidepressant prescriptions, Scientific Reports, DOI: 10.1038/s41598-020-79924-5
01.10.2020
Eine Umkehr der Invasion gebietsfremder Arten ist nicht in Sicht, denn der globale Handel und Verkehr, der vielen Arten als Mitfahrgelegenheit in neue Lebensräume dient, dürfte sich in den nächsten Jahrzehnten noch verstärken. „Wir können die Einschleppung gebietsfremder Arten nicht gänzlich verhindern, denn das würden starke Einschränkungen des Handels bedeuten. Aber mit strengeren Regularien und deren strikter Umsetzung können wir die Flut der neuen Arten eindämmen. Der Nutzen entsprechender Maßnahmen ist durch Studien belegt. Gerade in Europa, wo die Regelungen noch vergleichsweise locker sind, gibt es noch viele Möglichkeiten, die Einbringung neuer Arten zu vermeiden“, konstatiert Seebens abschließend.Textfeld >>
Ebola-übertragende Tiere womöglich weiter verbreitet als angenommen
07.09.2020
Mit Blick auf Europa sagt Klimpel: „Ebolaviren sind, wie auch das SARS-CoV-2, gemeinhin als Coronavirus bekannt, Viren aus dem Tierreich, die auf den Menschen überspringen können. Zukünftig werden derartige Krankheiten, sogenannte Zoonosen, vermutlich verstärkt auftreten, da der Mensch zum Beispiel häufigeren Kontakt mit Wildtieren hat und die Globalisierung dem Virus hilft, sich weltweit zu verbreiten. In Europa mit seinem prinzipiell guten Gesundheitssystem ist Ebola auch in Zukunft sicher ein Einzelfall. Nichtsdestotrotz lohnt es sich angesichts dieser Trends auch in unseren Breiten intensiver Ärzt*innen und Pflegepersonen im Umgang mit tropischen Infektionskrankheiten aus- und weiterzubilden.“
24.08.2020
Ein Großteil der Erkenntnisse darüber, wie die Menschheit von biologischer Vielfalt profitiert, stammt aus Biodiversitätsversuchsflächen wie dem „Jena Experiment“. Kritiker*innen bemängeln jedoch seit langem, dass dort Artengemeinschaften wachsen, die in der Natur nicht vorkommen. Senckenberg-Forschende haben jetzt untersucht, ob sich biologische Vielfalt positiv auf die Leistungen eines Ökosystems auswirkt oder ob der Effekt dem Design dieser Flächen geschuldet ist. Dazu wurden in einer neuen Studie unrealistische Versuchsflächen identifiziert und in der Analyse ausgespart. Trotzdem änderten sich die Ergebnisse kaum. Dies belege eindeutig, dass die aus den Versuchsflächen erlangten Erkenntnisse zur biologischen Vielfalt als essentielle Lebensgrundlage der Menschheit valide seien, schreibt das Team aktuell in „Nature Ecology & Evolution“.
Intensive Landnutzung durch den Menschen beeinträchtigt weltweit die Bestäubung
11.08.2020
Die intensive Landnutzung durch den Menschen beeinträchtigt weltweit die Bestäubung von Wildpflanzen und deren Fortpflanzungserfolg. Das betrifft insbesondere Pflanzen, die in ihrer Bestäubung hochspezialisiert sind. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ), die in Nature Communications wurde. Mithilfe eines globalen Datensatzes ist es dem Forschungsteam gelungen, diesem Zusammenhang zu untersuchen.
Pflanzen bieten wichtige Ressourcen wie Nahrung und Schutz für alle anderen lebenden Organismen auf der Erde. Ein Großteil der Pflanzen ist für die Fortpflanzung auf Bestäuber angewiesen – deshalb
sind Forschungsergebnisse, die einen weitverbreiteten Rückgang der Bestäuber zeigen, so besorgniserregend. Doch bislang ist wenig darüber bekannt, welche Pflanzen von diesem Rückgang besonders
betroffen sein werden und unter welchen Umständen sich ihr Fortpflanzungserfolg verringert.
Veränderungen der Landnutzung können den Bestand von Pflanzen und ihren Bestäubern sein. Doch die Auswirkungen auf verschiedene bestäubende Tiere sind nicht immer gleich: Während manche landwirtschaftlichen Praktiken vorteilhaft für Honigbienen sein können, führen sie möglicherweise zu einem Rückgang anderer Bestäuber wie Wildbienen und Schmetterlingen. Dr. Joanne Bennett, die die Studie als Wissenschaftlerin bei iDiv und an der MLU geleitet hat und heute an der Universität von Canberra forscht, sagt: „Die Beziehungen zwischen Pflanzen und ihren Bestäuber haben sich über Millionen von Jahren entwickelt. Die Menschen verändern diese Beziehungen jetzt innerhalb weniger Jahre.“
Ein globaler Datensatz zu Landnutzung und Pollenlimitierung
Um eine Verbindung zwischen Landnutzung und der Aufnahme von Pollen herzustellen, erstellte das internationale Forscherteam einen globalen Datensatz, der zeigt, inwieweit der reproduktive Erfolg von Wildpflanzen aufgrund einer verminderten Aufnahme von Pollen eingeschränkt ist. Dazu analysierte es Tausende bereits veröffentlichter Studien zu Experimenten, bei denen Pflanzen händisch bestäubt wurden. Bei solchen Experimenten wird verglichen, wie viele Samen Pflanzen produzieren, die auf natürliche Weise bestäubt worden sind, und wie viele Samen in händisch bestäubten Pflanzen entstehen. Joanne Bennett erklärt: „Wenn die Pflanzen, die auf natürliche Weise bestäubt wurden, weniger Früchte oder Samen produzieren als die Pflanzen, die zusätzlich von Hand bestäubt wurden, dann ist die Fortpflanzung dieser Pflanzen eingeschränkt – man spricht von einer Pollenlimitierung. Solche Experimente sind hervorragend dazu geeignet, den Fortpflanzungserfolg von Pflanzen und die Bestäubung zueinander in Bezug zu setzen.“
Vor fast 20 Jahren begann Prof. Dr. Tiffany Knight, Alexander-von-Humboldt-Professorin an der MLU und Leiterin der Forschungsgruppe Räumliche Interaktionsökologie bei iDiv sowie am UFZ, mit der Zusammenstellung des ersten Datensatzes. Mit der Unterstützung des iDiv-Synthesezentrums sDiv riefen Knight und Bennett eine 16-köpfige, international besetzte Forschergruppe ins Leben, die den Datensatz erweiterte und neue Ideen einbrachte. Zu Beginn des Projektes lagen den Forschern Daten aus 1,000 Experimenten zu 306 Pflanzenarten aus Europa und Nordamerika vor. Heute umfasst die Sammlung Daten aus über 2.000 Experimenten zu über 1.200 Pflanzenarten und Informationen zu Experimenten aus der ganzen Welt. „Die Zusammenarbeit mit einem internationalen Team hat dieses Projekt zu etwas ganz Besonderem gemacht – ebenso wie der Umstand, dass wir viele Studien mit aufnehmen konnten, die nicht in englischer Sprache vorlagen“, sagt Tiffany Knight.
Starke Einschränkungen bei Spezialisten und Pflanzen in intensiv genutzten Landschaften
All diese Daten erlaubten letztendlich eine globale Metaanalyse, die zeigte, dass Wildpflanzen in intensiv genutzten Landschaften, wie in urbanen Regionen, in ihrer Bestäubung stark eingeschränkt sind. Die Forscher fanden heraus, dass das Risiko bei Pflanzen, die bei der Bestäubung eine hohe Spezialisierung aufweisen, besonders hoch ist. Allerdings zeigten sich hier auch Unterschiede – je nachdem, um welche Form der Landnutzung es sich handelte und auf welche Bestäuber sich die Pflanzen spezialisiert haben.(So war die Bestäubung bei Wildpflanzen, die sich auf Bienen als ihre Bestäuber spezialisiert haben, in landwirtschaftlich genutzten Gebieten weniger eingeschränkt als bei solchen Pflanzen, die auf andere Bestäuber spezialisiert sind. Das liegt möglicherweise daran, dass Honigbienen in diesen Gebieten auch Wildpflanzen bestäuben.
Die Ergebnisse der Studie zeigen eine klare Verbindung zwischen einer intensiven Landnutzung und einem geringeren Fortpflanzungserfolg von Pflanzen aufgrund einer verringerten Bestäubung. Zukünftige Veränderungen der Landnutzung könnten dazu führen, dass der Bestäubungs- und Fortpflanzungserfolg von Pflanzen weiter abnimmt und Pflanzengemeinschaften immer stärker von sogenannten Generalisten dominiert werden, die in Bezug auf ihre Bestäuber wenig wählerisch sind.
Originalpublikation (Wissenschaftler mit iDiv-Affiliation und Alumni fett):
Joanne M. Bennett, Janette A. Steets, Jean H. Burns, Laura A. Burkle, Jana C. Vamosi, Marina Wolowski, Gerardo Arceo-Gómez, Martin Burd, Walter Durka, Allan G. Ellis, Leandro Freitas, Junmin Li, James G. Rodger, Valentin Ştefan, Jing Xia, Tiffany M. Knight, Tia-Lynn Ashman (2020). Land use and pollinator dependency drives global patterns of pollen limitation in the Anthropocene. Nature Communications. DOI: 10.1038/s41467-020-17751-y
Braune Hundezecke
23.07.2020
Ursprünglich aus Afrika stammend, ist die Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus) sie inzwischen auch im Mittelmeerraum und der
Schweiz zu finden. Von dort wird sie immer mal wieder nach Deutschland eingeschleppt. „Es wurden aber auch bereits Exemplare an Hunden gefunden, die ihren Hof nie verlassen hatten“, berichtet Prof.
Dr. Ute Mackenstedt, Parasitologin und Zeckenexpertin an der Universität Hohenheim in Stuttgart. „Damit können sie kein unbeabsichtigtes Urlaubsmitbringsel sein – ein Hinweis darauf, dass sich die
Art hier möglicherweise bereits entwickeln kann.“ Für ihre Forschung bittet die Universität Hohenheim die Bevölkerung auch dieses Jahr wieder, Funde der Braunen Hundezecke mit Bild zu
melden.
Hundebesitzer kennen das: Bei einem Ausflug in Wald und Wiesen hat der Hund ein paar unerwünschte Gäste „eingesammelt“, die am besten sofort entfernt werden sollten. Denn auch wenn Zecken zunächst
einmal für Mensch und Tier nur unangenehm und lästig sind, können manche Exemplare auch Krankheiten auf Mensch und Tier übertragen.
Zwar befallen Braune Hundezecken in erster Linie Hunde und können ihn dabei mit verschiedenen Krankheiten infizieren; wenn aber ihr bevorzugter Wirt gerade nicht verfügbar ist, stechen sie auch den
Menschen und können so zum Beispiel die Erreger für das Mittelmeerfleckfieber weitergeben.
Eine Braune Hundezecke kommt selten allein
Beim Hund verursacht der Stich einer einzelnen Braunen Hundezecke meist lediglich geringe Hautirritationen. Doch kommt eine Braune Hundezecke selten allein. Häufig sitzen mehrere bis viele dieser
Plagegeister sehr dicht nebeneinander, wenn sie ihre Blutmahlzeit aufnehmen.
„Dabei bevorzugen sie gut durchblutete Körperbereiche des Hundes mit dünner Haut, wie beispielsweise Ohren, Leisten, Achselhöhlen, der Rücken oder die Zehenzwischenräume“, erläutert Katrin Fachet,
Doktorandin im Fachgebiet Parasitologie.
Werden die Zecken mit dem Hund oder beispielsweise seinem Hundebett nach Deutschland transportiert, können sie auch in Innenräumen lange überleben und sich dort vermehren. Hauptsächlich sind sie dann
bevorzugt an den Orten zu finden, an denen die Hunde die Nächte oder lange Ruhezeiten verbringen, wie zum Beispiel dem Hundebett oder in der Hundehütte.
„Eingeschleppt“ heißt nicht automatisch, dass die Zecke bei uns schon heimisch ist
In den letzten beiden Jahren wurden den Expertinnen der Parasitologie in Hohenheim aus 15 verschiedenen Haushalten in Deutschland Braune Hundezecken gemeldet. „Meist waren dies Urlauber, die mit
ihren Hunden aus dem Mittelmeerraum oder der Schweiz zurückgekommen sind“, erläutert Katrin Fachet. Und sie fügt hinzu. „Bei einem Fall hatte sich der Hund die Zecken wohl im Urlaubsquartier in den
Niederlanden geholt.“ Daraus könne man jedoch nicht ableiten, dass sie in Deutschland schon heimisch seien.
Aber sie kann in unseren Wohnräumen überleben und sich vermehren
Nach einer Blutmahlzeit verlassen die Zecken ihren Wirt und ziehen sich in Spalten und Ritzen zurück, die sie vor Umwelteinflüssen schützen. Auch hinter Fußleisten, unter Dielen und hinter Tapeten
oder in Natursteinwänden in der Wohnung sind sie zu finden.
„Anders als unser heimischer Gemeiner Holzbock, ist die Braune Hundezecke an hohe Temperaturen und Trockenheit angepasst und kann auch in Wohnungen überleben. Ist dann noch ein Hund vor Ort, kann sie
schnell zur Plage werden“, so Katrin Fachet.
„Ein Hundezeckenweibchen kann bis zu 5.000 Eier legen, woraus sich innerhalb kurzer Zeit mehrere Tausend Zecken entwickeln können“, erklärt Prof. Dr. Mackenstedt. „Ein Wohnungsbefall durch die Braune
Hundezecke ist unschön und mehr als ärgerlich – aber kein Grund, gleich die Abrissbirne zu schwingen“, unterstreicht sie noch. „Mit geeigneten Maßnahmen bekommt man das wieder in den Griff.“
Prophylaxe ist der beste Schutz
Um es gar nicht erst soweit kommen zu lassen, empfehlen die Expertinnen eine wirksame Zeckenprophylaxe, so dass die Tiere erst gar nicht mit nach Hause genommen werden können. Dies könne über
geeignete Zeckenhalsbänder oder Spot-On-Präparate geschehen, die auf das Fell aufgetragen werden, oder mit systemisch wirksamen Mitteln, wie zum Beispiel Kautabletten. Der Tierarzt kann hier
beraten.
Forschung an Brauner Hundezecke geht weiter
Insgesamt ist jedoch noch wenig über die Braune Hundezecke bekannt. So weiß man beispielsweise nicht, ob sie in Deutschland auch außerhalb von Wohnungen überleben kann und ob dies angesichts der
Klimaveränderungen eventuell möglich werden könnte. Auch ist noch ungeklärt, ob sie auch von Hund zu Hund übertragen werden kann.
Wie gelangt die Zecke überhaupt nach Deutschland? Welche Krankheitserreger führt sie mit sich? Welche Maßnahmen gegen einen Befall in der Wohnung können getroffen werden? Sind weitere Fragen, denen
sich Katrin Fachet in ihrer Doktorarbeit widmen möchte, und: „Wir wollen die betroffenen Fälle gerne betreuen – vom Anfang bis zum Ende des Befalls.“
Parasitologie der Universität Hohenheim bittet Bevölkerung wieder um Mithilfe
Dazu bittet sie wieder um die Mithilfe der Bevölkerung: Wer häufiger eine ungewöhnlich große Anzahl an Braunen Zecken in einem Gebäude bemerkt oder wessen Hund sehr stark von Zecken befallen sein
sollte, die der Braunen Hundezecke ähnlich sehen, soll sie in ein kleines, luftdichtes Gefäß, wie zum Beispiel einen Kunststoff-Cremetiegel, ein sehr kleines Einmachglas oder Ähnliches geben.
Die Expertin freut sich, wenn sie zunächst eine E-Mail mit einer Großaufnahme der Zecke an hundezecken@uni-hohenheim.de geschickt
bekommt. Sie wird sich dann schnellstmöglich beim Finder mit einer Einschätzung melden, ob es sich um eine Braune Hundezecke handeln könnte und ob es sinnvoll ist, den Fund auf dem Postweg an die
Universität Hohenheim einzuschicken.
„Schön wäre es, wenn die Zecke nicht mit Tesafilm oder anderen Klebstoffen in Berührung kommt. Denn für die eindeutige Zuordnung brauchen wir feine Härchen und Oberflächenstrukturen, die sich dann
nicht mehr erkennen lassen“, ist Katrin Fachet noch wichtig. Weitere Informationen gibt es unter: https://hundezecken.uni-
HINTERGRUND: Das Hundezecken-Projekt
Schon seit vielen Jahren widmen sich die Parasitologinnen und Parasitologen der Universität Hohenheim der Erforschung verschiedener Zeckenarten. Dabei werden sie häufig von Tierheimen,
Veterinärmedizinern und Jägern unterstützt, denn manche Zeckenarten lassen sich nicht einfach in der Natur sammeln. So wie die Braune Hundezecke.
Diese Zecken sind nach bisherigem Stand in Deutschland nicht heimisch, werden aber regelmäßig aus dem Ausland - vor allem aus dem Mittelmeerraum - eingeführt. Sie sind an die Lebensräume von Menschen
angepasst und können in Wohnräumen überleben und sich vermehren.
Im Hundezecken-Projekt soll das Vorkommen dieser Zeckenart in Deutschland untersucht werden. Die Mithilfe der Bevölkerung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Die Zusammenarbeit ist auch für sie
vorteilhaft: Die Zecken werden von Experten bestimmt und untersucht. Nur so können wirksame Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Die Ergebnisse werden den Einsendern natürlich mitgeteilt.
Weitere Informationen
https://hundezecken.uni-
Klimawandel lässt Vegetation ergrünen und sprießen
10. Juli 2020
Durch höhere Kohlenstoffdioxidwerte in der Luft wachsen in den asiatischen Tropen bis zum Jahr 2100 mehr immergrüne Pflanzen als bisher; laubabwerfende Pflanzen hingegen gehen zurück.
Zudem wird die Vegetation der Region in Zukunft stärker in die Höhe wachsen. Das ist das Ergebnis einer Simulation von Senckenberg-Wissenschaftler*innen die kürzlich im Fachmagazin „Global Change Biology“ erschienen ist. In Folge dieser Entwicklung entsteht in den asiatischen Tropen bis zum Ende des Jahrhunderts im Mittel bis zu 23 Prozent mehr oberirdische holzige Biomasse. Die Region könnte daher eine globale Kohlenstoffsenke sein, vorausgesetzt heutige Flächen mit natürlicher Vegetation werden nicht gerodet.
Zwischen Afghanistan im äußersten Westen und Papua-Neuguinea im Osten liegen die asiatischen Tropen, die als eine der dichtbesiedelsten Gebiete der Erde gelten. Die riesige Region ist im Hinblick auf ihre biologische Vielfalt bemerkenswert: sieben der 36 weltweiten Biodiversitäts-Hotspots findet man dort. Im subtropischen bis tropischen Klima gedeiht eine Pflanzenvielfalt die ihresgleichen sucht – von grasdominierten Savannen bis hin zum Dschungel immergrüner Regenwälder.
Dieser Pflanzenwelt stehen große Veränderungen bevor: „Durch höhere Kohlenstoffdioxidwerte in der Luft wird die Vegetation in Indien und dem westlichen Teil Südostasiens bis zum Jahr 2100 stellenweise mehr als zehn Prozent an Höhe zulegen. Zudem wird es in den asiatischen Tropen insgesamt mehr immergrüne Pflanzen geben, während die laubabwerfende Vegetation zurückgeht“, so Dr. Simon Scheiter, Wissenschaftler am Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum.
Scheiter hat mit seinem Team anhand eines dynamischen Vegetationsmodells untersucht, wie sich der Klimawandel auf die Vegetation der asiatischen Tropen auswirkt. Die Forscher*innen simulierten, wie sich die Pflanzen unter Klimawandel-Szenarien mit moderaten und sehr hohen Kohlenstoffdioxid-
Die Zunahme der Höhe und der immergrünen Wuchsform ist vornehmlich Bäumen zuzuschreiben. Deshalb wird die holzige Biomasse in der gesamten Region – mit Ausnahme von Pakistan und Afghanistan – bis zum Ende des Jahrhunderts ebenfalls signifikant steigen. Scheiter dazu: „Wir haben für die oberirdische Biomasse in den asiatischen Tropen im Zeitraum 2080 bis 2099 bei sehr hohen Treibhauskonzentrationen ein Plus von 22,8 Prozent gegenüber heute berechnet. Bei moderaten Treibhauskonzentrationen ist ein Plus von 12,7 Prozent zu erwarten.“
Die Gebiete in den asiatischen Tropen, die durch natürliche Vegetation bedeckt sind, werden daher den Forscher*innen zufolge bis zum Ende des Jahrhunderts eine globale Kohlenstoffsenke bilden. Vorrausetzung ist, dass die heutigen Flächen mit natürlicher Vegetation nicht gerodet werden, um Platz für Äcker, Weiden und Plantagen zu schaffen. Zudem demonstrieren die Ergebnisse, dass es sich lohnen könnte, in der Region ehemalige Waldgebiete wieder aufzuforsten, um den Klimawandel zu bremsen.
Das ist aber nur eine Seite der Medaille, wie Scheiter betont: „Unsere Simulation zeigt, dass Landschaften mit geringem Baumbestand und laubwerfender Vegetation am stärksten durch den Klimawandel beeinträchtigt werden und das Ergrünen der Region Lebensräume komplett verändern wird. Wenn Graslandschaften und grasdominierte Savannen schrumpfen, könnten die dort heimischen Pflanzen und Tiere verschwinden oder ganz aussterben. Um dem Klimawandel zu begegnen, müssen wir deshalb eine Lösung finden, die sowohl Klima- als auch Artenschutz berücksichtigt.“
Hunderte unbekannter Insektenarten in Deutschland
30.06.2020
Direkt vor der eigenen Haustür gibt es eine Menge unbekannter Arten. Viele davon sind vom Aussterben bedroht. Doch um sie schützen zu können, müssen wir sie erst einmal kennen.
Um neue Arten zu entdecken, muss man nicht in ferne Länder reisen: Direkt vor der eigenen Haustür gibt es jede Menge Tiere, Pflanzen und Pilze, die der Wissenschaft noch gar nicht bekannt
sind. Fachleute sprechen dann von den sogenannten „Dark Taxa“. Das sind Arten, die entweder noch gar keine Namen haben oder deren Einordnung extrem schwierig ist. „Um jedoch effektivere
Schutzmaßnahmen zum Beispiel gegen das Insektensterben ergreifen zu können, müssen wir besser verstehen, welche Arten es überhaupt gibt und welche Funktionen sie im Ökosystem haben“, erklärt der
Insektenkundler Professor Lars Krogmann. Er leitet das Fachgebiet Systematische Entomologie an der Universität Hohenheim und gleichzeitig die entomologische Abteilung des Naturkundemuseums Stuttgart
(SMNS). Mit dem Ziel, Licht ins Dunkel zu bringen, startete vor acht Jahren die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte deutsche Barcode-of-Life-Initiative. Sie hat zum
Ziel, die Artenvielfalt aller deutschen Tiere, Pilze und Pflanzen anhand ihres DNA-Barcodes, also des genetischen Fingerabdrucks, zu erfassen. Im Juli 2020 geht das Projekt in die dritte
Projektphase, bei der zwei bislang eher vernachlässigte Insektengruppen im Fokus stehen sollen. Neu im Aufbau befindet sich auch das Kompetenzzentrum Biodiversität und integrative Taxonomie, eine
Gemeinschaftseinrichtung der Universität Hohenheim und dem Naturkundemuseum Stuttgart, getragen von der Initiative „Integrative Taxonomie“ des Landes Baden-Württemberg.
Die Tatsache, dass es in Deutschland noch eine Vielzahl unbekannter Arten gibt, mag zunächst überraschen. „Das liegt meist nicht daran, dass wir sie noch nicht gefunden hätten“, erläutert Krogmann,
„sondern daran, dass sich vor allem die kleineren Insekten so ähnlich sehen können, dass sie äußerlich nicht unterscheidbar sind.“ Da könne es leicht passieren, dass man meine, nur eine Art vor
sich zu haben. Dabei seien es aber in Wirklichkeit zwei, drei oder sogar noch mehr verschiedene sogenannte kryptische Arten, die durchaus unterschiedliche ökologische Ansprüche haben können.
Das Problem des Insektensterbens besteht – unabhängig davon, dass es noch unbekannte Arten gibt
Nach Schätzungen warten weltweit ca. 80 Prozent aller Insektenarten darauf, entdeckt und beschrieben zu werden. „Leider werden es jeden Tag weniger“, bedauert Krogmann „Viele Arten verschwinden,
bevor wir sie überhaupt entdeckt haben. Und auch wenn rein rechnerisch so jedes Jahr neue Arten zum Katalog dazukommen, nimmt die Gesamtzahl aller Insekten doch deutlich ab.“ Deshalb ist es umso
wichtiger, die Artenvielfalt unseres Planeten so schnell und umfassend wie möglich zu erfassen, damit effektive Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. „Man kann nur schützen, was man kennt“, betont
Krogmann.
In Deutschland widmet sich seit 2012 das vom BMBF geförderte Projekt German Barcode of Life (GBOL) dieser Aufgabe. Das deutschlandweite Netzwerk aus verschiedenen Naturkundemuseen und anderen
Biodiversitätsforschungsinstituten sammelt dazu umfassend und flächendeckend Tier- und Pflanzenarten in ganz Deutschland. Diese werden mit modernen Methoden untersucht, katalogisiert,
wissenschaftlich beschrieben und ihr Erbgut analysiert. Alle Daten werden zunächst in der ersten umfassenden „DNA-Barcoding“-Gendatenbank der Fauna und Flora Deutschlands zusammengeführt und
anschließend in eine weltweite Datenbank eingespeist, so dass die Informationen auch anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern für ihre Forschung zur Verfügung stehen.
Insekten sind nicht nur als Bestäuber wichtig
Ein erheblicher Teil der Insektenarten musste bislang jedoch in den bisherigen GBOL-Projekten und letztlich der gesamten Biodiversitätsforschung ausgeschlossen werden, da es in Deutschland keine oder
nur sehr unzureichende Fachkenntnisse und Informationen gibt. Dabei machen die Zweiflügler, wie zum Beispiel Mücken und Fliegen, und die Hautflügler, zu denen unter anderem auch Bienen und Wespen
gehören, rund zwei Drittel aller Insektenarten in Deutschland aus. Diese Lücke möchte nun das Folgeprojekt GBOLIII schließen.
„Hautflügler spielen eine zentrale Rolle in unseren Ökosystemen“, erläutert Krogmann sein Interesse für diese Insektengruppe. „Einerseits als Bestäuber von Blütenpflanzen ‒ daran denkt jeder sofort.
Andererseits sorgen sie aber auch als natürliche Gegenspieler anderer Insekten für ein natürliches Gleichgewicht – und das wird leider oft außer Acht gelassen.“
Zweiflügler seien ökologisch gesehen vielleicht die vielseitigste Insektenordnung. "Sie spielen eine entscheidende Rolle als Zersetzer, Bestäuber, Gegenspieler und stellen einen großen Teil der
Nahrung von Wirbeltieren“, sagt Daniel Whitmore, Kurator für Zweiflügler am SMNS. „Unser geringer Kenntnisstand zur Vielfalt und Verbreitung vieler Fliegen- und Mückengruppen verhindert den
effektiven Schutz ihrer Habitate und der von ihnen abhängigen Arten.“
Ökologischer Ansatz soll bei Artbestimmung helfen
So sind rund 80 Prozent aller Hautflügler-Arten parasitische Wespen, die ihre eigenen Eier in die Eier anderer Insekten, deren Raupen, Puppen oder in die ausgewachsenen Tiere legen. Während sich aus
den Eiern neue Wespen entwickeln, geht der Wirtsorganismus zugrunde. Im biologischen Pflanzenschutz werden parasitische Wespen deswegen oft auch als Nützlinge eingesetzt.
Doch wahrscheinlich sind gerade diese Insekten besonders stark vom Insektensterben betroffen, da sie auf ausreichend große Bestände ihrer Insektenwirte angewiesen sind. „Bislang können wir dies nur
vermuten“, so Krogmann, „denn es fehlen Daten zum Vorkommen und zur Verbreitung parasitischer Wespen. Zudem sind sie meist nur wenige Millimeter groß, was ihre Artbestimmung enorm erschwert.“
Einer neuer Ansatz soll – neben den genetischen Untersuchungen – hier weiterhelfen, sagt Krogmann: „Wir beziehen auch die Lebensweise der Insekten bei ihrer Bestimmung mit ein. Gerade parasitische
Arten sind sehr spezialisiert: So können nah verwandte Arten, die äußerlich fast völlig gleich aussehen, ganz unterschiedliche Insektenwirte befallen.“
Neue Artenspezialisten werden gebraucht
Gleichzeitig soll im Rahmen von GBOLIII auch eine neue Generation von Taxonominnen und Taxonomen, den Spezialisten zur Artidentifikation, ausgebildet werden. „Denn davon gibt es leider viel zu
wenige“, betont Krogmann, „und sie werden mehr denn je gebraucht, wenn wir den aktuellen dramatischen Insektenrückgang verstehen und bekämpfen wollen.“ Weil es in Deutschland an den entsprechenden
Expertinnen und Experten mangelt, hat er sich weltweite Unterstützung gesucht. So gibt es z. B. Fachleute in den USA, Australien oder Rumänien, die ihr Wissen an die neuen Hohenheimer Doktoranden und
Doktorandinnen weitergeben möchten. Darüber hinaus will das Projekt durch regelmäßige Konferenzen und Zusammenkünfte den Wissensaustausch der Forscherinnen und Forscher untereinander fördern.
HINTERGRUND: GBOLIII: Dark Taxa
Ziel von GBOLIII: Dark Taxa ist es, das Wissen über die deutsche Fauna in den beiden vielfältigsten und bisher am wenigsten untersuchten Gruppen der Zweiflügler und der Hautflügler zu
erweitern.
Die Projektleitung hat das Zoologische Forschungsmuseum Alexander Koenig Bonn. Projektpartner sind, neben dem Staatlichen Museum für Naturkunde Stuttgart (SMNS), die Staatlichen
Naturwissenschaftlichen Sammlungen Bayerns, die Universität Würzburg und der Entomologische Verein Krefeld.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert das Projekt mit rund 5,4 Millionen Euro, davon entfallen knapp 1,4 Millionen Euro auf das SMNS. Mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren wird
das Projekt am 1. Juli 2020 starten. Weitere Details unter www.bolgermany.de/wp/
HINTERGRUND: Kompetenzzentrum Biodiversität und integrative Taxonomie
Im Rahmen der „Initiative Integrative Taxonomie“ beschloss die Landesregierung im Herbst 2019 den Aufbau eines Kompetenzzentrums Biodiversität und integrative Taxonomie als Gemeinschaftseinrichtung
der Universität Hohenheim und des Naturkundemuseums Stuttgart. Aufgabe des Zentrums ist es, das Thema sowohl in Wissenschaft und Forschung als auch in der Fort- und Weiterbildung für die Praxis
abzudecken.
HINTERGRUND: Wissenschaftsjahr 2020 Bioökonomie
2020 steht das Wissenschaftsjahr im Zeichen der Bioökonomie – und damit einer nachhaltigen, biobasierten Wirtschaftsweise. Es geht darum, natürliche Stoffe und Ressourcen nachhaltig und innovativ zu
produzieren und zu nutzen und so fossile und mineralische Rohstoffe zu ersetzen, Produkte umweltverträglicher herzustellen und biologische Ressourcen zu schonen. Das ist in Zeiten des Klimawandels,
einer wachsenden Weltbevölkerung und eines drastischen Artenrückgangs mehr denn je notwendig. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ausgerichtete Wissenschaftsjahr Bioökonomie
rückt das Thema ins Rampenlicht.
Die Bioökonomie ist das Leitthema der Universität Hohenheim in Forschung und Lehre. Sie verbindet die agrarwissenschaftliche, die naturwissenschaftliche sowie die wirtschafts- und
sozialwissenschaftliche Fakultät. Im Wissenschaftsjahr Bioökonomie informiert die Universität Hohenheim in zahlreichen Veranstaltungen Fachwelt und Öffentlichkeit zum Thema. Im Monat Juni steht das
Thema Artenvielfalt im Mittelpunkt.
Weitere Informationen
GBOLIII: Dark Taxa: https://www.bolgermany.de/wp/
Wissenschaftsjahr 2020 BMBF: https://www.wissenschaftsjahr.
#Wissenschaftsjahr2020 #DasistBioökonomie
Wissenschaftsjahr 2020 Hohenheim: https://www.uni-hohenheim.de/
Bioökonomie an der Universität Hohenheim: https://biooekonomie.uni-
Expertenliste Bioökonomie: https://www.uni-hohenheim.de/
Fahrspuren helfen der Unke – wenn wir es zulassen
14.04.2020
Durch die Stürme der vergangenen Wochen sind in vielen Wäldern im Landkreis teils erhebliche Schäden entstanden. Dort, wo die Gelbbauchunke vorkommt, können die bei der Aufarbeitung entstehenden Fahrspuren sehr hilfreich sein.
Im Februar/März sind starke Stürme über Oberbayern gefegt und haben viele Bäume umgeworfen oder gebrochen. In vielen Waldgebieten sind nun Menschen mit Maschinen unterwegs, um entsprechendes Holz zu entnehmen. Dabei sind Fahrspuren der Fahrzeuge unvermeidlich. Ist das gut oder schlecht? Erholungssuchende erfreuen sich an einem harmonischen Waldbild und stören sich unter Umständen an den zerfurchten Waldböden. Aus der Sicht der Gelbbauchunke bietet sich aber ein ganz anderes Bild.
Eine andere Sicht der Dinge
Die Gelbbauchunke ist ein kleiner Froschlurch und seit jeher in unseren Wäldern heimisch. Ihre natürlichen Laichgewässer gingen jedoch vielerorts beispielsweise durch trockene Sommer verloren. Daher stellen mit Wasser gefüllte Fahrspuren im Wald einen wichtigen Ersatzlebensraum für die stark gefährdete Unke dar und sollten nicht restlos verfüllt werden. Dort, wo es Unken gibt, sind sie deshalb auf die Mithilfe von uns Menschen angewiesen, um ihrem Nachwuchs ein Überleben zu ermöglichen.
Kleine Gewässer, Quelltümpel, Viehweiden, aber auch Pfützen und wassergefüllte Fahrspuren: Hier fühlt sich die Gelbbauchunke wohl, hier legt sie ihre Eier ab. Doch durch Trockenlegungen und Straßenbauten sind diese Laichgewässer immer weniger geworden, und in der Folge auch die Tiere. Ziel ist es nun, neue Lebensräume zu schaffen, Biotope aufzubessern und zu vernetzen, um die Unkenwanderung wieder zu ermöglichen. Dazu braucht es engagierte Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer und Kiesabbauunternehmen sowie Privatpersonen, die die Laichgewässer freiwillig erhalten und pflegen. Forst-, Land- und Wasserwirtschaft sind ebenso angesprochen wie Gemeinden und Schulen.
Wenn Sie also etwas für die heimische Gelbbauchunke tun wollen, melden Sie sich, wir beraten Sie gerne! Schreiben Sie eine Mail an
judith.jabs-ingenhaag@kreis-
„Allen Unkenrufen zum Trotz“
Sechs oberbayerische Landkreise beteiligen sich mit dem groß angelegten Projekt „Allen Unkenrufen zum Trotz“ am Erhalt der Gelbbauchunke, die laut der bundesweiten Roten Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze in ihrem Bestand stark gefährdet ist. Gefördert wird das Projekt durch das Bundesamt für Naturschutz (BfN) mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) im Rahmen des Bundesprogramms Biologische Vielfalt und durch den Bayerischen Naturschutzfonds. Träger des Projektes „Allen Unkenrufen zum Trotz“ sind die Landkreise Altötting, Freising und Neuburg-Schrobenhausen, der BUND Naturschutz in Bayern e. V. mit seinen Kreisgruppen Altötting, Erding, Freising, Mühldorf a. Inn, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen a. d. Ilm. Insgesamt fließen in fünf Jahren 670.000 Euro in verschiedene Maßnahmen, so dass sich die Bestände der Gelbbauchunke bis zum Ende der Laufzeit am 30. Juni 2021 möglichst erhöht haben werden. Da ein großer Teil der Weltpopulation der „Bombina variegata“ in Deutschland vorkommt, hat Deutschland für dieses Tier eine ganz besondere Verantwortung.
Die Landkreise Altötting, Freising, Neuburg-Schrobenhausen sowie der BUND Naturschutz in Bayern e.V. haben zum Zweck der Umsetzung des Projektes eine Trägergemeinschaft gebildet, für die der Landkreis Freising die Geschäftsführung übernommen hat. Mit im Boot sind auch das Wissenschaftszentrum Weihenstephan mit der TU München und der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf, die mit ihrem Fachwissen zum Gelingen des Projekts beitragen.
Trockenstress – Biologen entschlüsseln SOS-Signal von Pflanzen
14.04.2020
Peptidhormon steuert vorzeitigen Abwurf von Blüten und Früchten: Team der Universität Hohenheim entdeckt neuartigen Signalweg
Lange Trockenphasen und Dürren werden im Zuge des Klimawandels weiter zunehmen und können zu erheblichen Ernteeinbußen führen. Viele Kulturpflanzen, darunter Obstbäume, Baumwolle oder Sojabohne,
reagieren bei Anzeichen von Trockenstress mit einem vorzeitigen Abwurf von Blüten und unreifen Früchten, um keine Energie für die Ausbildung von Früchten zu vergeuden, die später nicht mehr ernährt
werden können. Welcher molekulare Steuerungsmechanismus dafür verantwortlich ist, haben Biologen der Universität Hohenheim in Stuttgart nun aufklärt. Ihre Ergebnisse präsentieren die beteiligten
Wissenschaftler in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazin Science unter: https://science.sciencemag.
Früchte oder Blätter abzuwerfen, ist für Pflanzen ein lebenswichtiger Vorgang, der hilft Samen zu verbreiten oder im Winter vor dem Austrocknen schützt. Wie der Abwurf von Pflanzenorganen unter
normalen Bedingungen ausgelöst wird, ist bereits gut untersucht. Gesteuert wird der Prozess in der sogenannten Abszissionszone, einem Trenngewebe am Stielansatz, dessen Aktivität von Pflanzenhormonen
reguliert wird. Während der normalen Fruchtentwicklung sorgt das wachstumsfördernde Auxin dafür, dass die Abszissionszone inaktiv bleibt, bei Fruchtreife oder wenn es im Herbst zum Laubfall kommt,
wird sie durch das Hormon Ethylen aktiviert.
Doch wenn die Pflanze unter Stress steht, insbesondere bei Trockenheit, kann es sinnvoll sein, Blüten und Blätter vorzeitig abzuwerfen: „Die Pflanze ist bestrebt, nur so viele Früchte auszubilden wie
sie auch ernähren kann. Wer einen Apfelbaum hat, kennt das Phänomen aus dem eigenen Garten: Im Juni fallen oft viele kleine Äpfel herunter. Nur die Verbleibenden reifen zu vollen, schönen Früchte
heran“, so Prof. Dr. Andreas Schaller, Leiter des Fachgebiets Physiologie und Biochemie der Pflanzen an der Universität Hohenheim.
Wie genau der vorzeitige Abwurf auf molekularer Ebene gesteuert wird, stellte für Wissenschaftler bislang jedoch ein Rätsel dar. Am Beispiel der Tomatenpflanze ist es dem Biologen-Team um Prof. Dr.
Andreas Schaller, Dr. Annick Stintzi und Dr. Sven Reichardt nun mit Hilfe des Biostatistikers Prof. Dr. Hans-Peter Piepho gelungen, dem zugrundeliegenden Mechanismus auf die Spur zu kommen:
Verantwortlich ist das Peptidhormon Phytosulfokin (PSK), das bislang nur für seine wachstumsfördernden und immunmodulierenden Aktivitäten bekannt war.
Peptidhormone unterscheiden sich grundlegend von den klassischen Pflanzenhormonen, wie Auxin oder Ethylen, die bereits gut erforscht sind. Peptidhormone werden zunächst als inaktive Vorstufen
gebildet und müssen erst durch Enzyme aktiviert werden, bevor sie ihre steuernde Wirkung ausüben können. Die Enzyme schneiden das Peptid sozusagen passend zurecht, damit es auf den zugehörigen
Rezeptor passt.
„Unsere Versuche haben gezeigt, dass die Aktivierung durch das Enzym Phytaspase 2 erfolgt, das die Vorstufe von Phytosulfokin ganz spezifisch spaltet und damit das Peptidhormon freisetzt. Das so
aktivierte Peptid bewirkt im Ansatz des Blütenstiels dann eine Auflösung der Zellwände und damit den Abwurf der Blüten“, erklärt Prof. Dr. Schaller.
Stressfaktoren wie Trockenheit haben einen Einfluss auf die Expression des Gens, welches für die Bildung des Enzyms Phytaspase 2 verantwortlich ist: „In unseren Versuchen konnten wir zeigen, dass
eine Aktivierung dieses Gens den Prozess in Gang setzt. Das Peptidhormon wird gebildet und das führt zu einem verstärkten Abwurf der Blüten, wohingegen ein Ausschalten des Gens den Abwurf
verhinderte“, fasst der Pflanzenbiologe zusammen.
Aktuelle Publikation
S. Reichardt, H.-P. Piepho, A. Stintzi, A. Schaller (2020): Peptide signaling for drought-induced tomato flower drop, SIENCE, Vol. 367, Issue 6485
DOI: 10.1126/science.aaz5641
Pflanzenvielfalt in Europas Wäldern nimmt ab
13.04.2020
In Europas gemäßigten Wäldern werden wenig verbreitete Pflanzenarten von jenen Arten verdrängt, die stärker verbreitet sind. Ein internationales Forscherteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für Integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) hat nun herausgefunden, dass diese Entwicklung mit einer erhöhten Stickstoffverfügbarkeit zusammenhängt. Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie im Fachmagazin Nature Ecology & Evolution.
Die Zahl der Tier- und Pflanzenarten nimmt ab – zumindest global betrachtet. Dem gegenüber stehen teils gegenläufige Entwicklungen in einzelnen lokalen Ökosystemen: Hier wird mitunter sogar eine Zunahme des Artenreichtums (Zahl der Arten) beobachtet. Doch wie lässt sich dieser vermeintliche Widerspruch erklären – und welche Ursachen liegen ihm zugrunde?
Ein internationales Team von Wissenschaftlern ist genau diesen Fragen nachgegangen. Anhand der Daten von insgesamt 68 verschiedenen Standorten in gemäßigten Wäldern Europas – darunter auch Waldstandorte in Thüringen, Brandenburg und Bayern – untersuchten sie, wie sich die Artenvielfalt krautiger Pflanzen im Laufe der vergangenen Jahrzehnte verändert hat. Dafür mussten die Forscher Bestandszahlen zu 1162 verschiedenen Pflanzenarten auswerten. Der Datensatz wurde von einem internationalen Netzwerk von Waldökologen, genannt forestREplot, zusammengetragen. „Dieses Netzwerk birgt den Vorteil, dass bei Unklarheiten die Experten für die jeweiligen Standorte direkt gefragt werden können. Es unterscheidet sich somit von vielen anderen großen Datenbanken“, erklärt Erstautor Ingmar Staude, der als Doktorand bei iDiv und der MLU forscht.
Die Auswertung dieser immensen Datenmenge wurde durch das iDiv-Synthesezentrum sDiv ermöglicht. Die Wissenschaftler fanden heraus, dass Pflanzenarten mit einer geringeren geographischen Verbreitung, die also oft in nur wenigen Wäldern zu finden sind, ein erhöhtes Risiko haben auszusterben. „Dies ist nicht so sehr auf eine geringere Populationsgröße solcher Pflanzen zurückzuführen, sondern vielmehr auf ihre ökologische Nische“, erklärt Ingmar Staude. Denn bei weniger weit verbreiteten Arten handelt es oft um solche, die daran angepasst sind, mit relativ wenigen Nährstoffen im Boden auszukommen.
Stickstoffliebende Pflanzen auf dem Vormarsch
Die Wissenschaftler konnten zeigen, dass chronische und exzessive Stickstoffeinträge in weiten Teilen Europas mit der erhöhten Aussterbewahrscheinlichkeit solcher Arten im Zusammenhang stehen. Dagegen profitieren Pflanzenarten, die nährstoffreiche Böden bevorzugen, wie die Brennnessel oder die Brombeere. Diese Pflanzen nutzen die erhöhte Nährstoffversorgung für ein verstärktes Wachstum – sie haben somit plötzlich einen Konkurrenzvorteil und verbreiten sich stärker.
Während also einige Arten mit einer geringeren Verbreitung verschwinden, verbreiten sich stickstoffliebende, teils exotische Arten. Der Artenreichtum in den einzelnen Wäldern hat sich daher im Durschnitt nicht verringert, der Gesamtartenreichtum jedoch schon. Basierend auf ihren Untersuchungen gehen die Forscher von einem Rückgang um vier Prozent während der letzten Jahrzehnte aus. Sie weisen jedoch darauf hin, dass die Untersuchungsstandorte in geschützten Waldgebieten liegen. Würde man zusätzlich Wälder betrachten, welche forstwirtschaftlich genutzt werden, könnte der Rückgang sogar noch weitaus größer sein.
Auswirkungen auf das gesamte Ökosystem
„Wir müssen jetzt herausfinden, ob die Prozesse, die wir im Wald beobachten, in anderen Biomen in ähnlicher Weise ablaufen“, so Ingmar Staude. Mithilfe des Synthesezentrums sDiv sollen deshalb erneut Daten in großem Stil ausgewertet werden – dieses Mal jedoch übergreifend für mehrere Biome, etwa für den europäischen Magerrasen und alpine Ökosysteme.
Der Artenverlust hat Auswirkungen auf die Ökosysteme: Wenn einzelne Pflanzenarten verschwinden, dann verschwinden mit ihnen auch manche Insektenarten und Bodenlebewesen. Und je weiter die Angleichung regionaler Floren voranschreitet, desto schlechter können die Ökosysteme auf sich ändernde Umweltbedingungen wie den Klimawandel reagieren. Die an der Studie beteiligten Wissenschaftler konnten zeigen, dass nur durch die Verringerung der Stickstoffeinträge das weitere Aussterben wenig verbreiteter Arten gestoppt werden kann. Diese Arten spielen eine wichtige Rolle für die Anpassungsfähigkeit unserer Waldökosysteme an sich ändernde Umweltbedingungen.
Kati Kietzmann. Originalpublikation:
Ingmar R. Staude, Donald M. Waller, Markus Bernhardt-Romermann, Anne D. Bjorkman, Jorg Brunet, Pieter De Frenne, Radim Hedl, Ute Jandt, Jonathan Lenoir, František Mališ, Kris Verheyen, Monika Wulf, Henrique M. Pereira, Pieter Vangansbeke, Adrienne Ortmann-Ajkai, Remigiusz Pielech, Imre Berki, Marketa Chudomelova, Guillaume Decocq, Thomas Dirnbock, Tomasz Durak, Thilo Heinken, Bogdan Jaroszewicz, Martin Kopecky, Martin Macek, Marek Malicki, Tobias Naaf, Thomas A. Nagel, Petr Petřik, Kamila Reczyńska, Fride Hoistad Schei, Wolfgang Schmidt, Tibor Standovar, Krzysztof Świerkosz, Balazs Teleki, Hans Van Calster, Ondřej Vild, Lander Baeten (2020). Replacements of small- by large-ranged species scale up to diversity loss in Europe’s temperate forest biome. Nature Ecology & Evolution, DOI: 10.1038/s41559-020-1176-8
Weiterführende Links:
Veränderung der Arten-Zusammensetzung in Ökosystemen weltweit
https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/1597.html
Mittelhäufige Pflanzenarten sind am stärksten zurückgegangen https://www.idiv.de/de/news/news_single_view/1608.html
Wir verlieren biologische Vielfalt gleich dreifach https://www.idiv.de/de/news/pressemitteilungen/press_release_single_view/591.html
Datenbank http://www.forestreplot.ugent.be/
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum
Tel. +49 (0)69- 7542 1876
isabel.donoso@senckenberg.de
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum
Tel. +49 (0)69- 7542 1892
matthias.schleuning@
Tote Tiere wichtig fürs Ökosystem
22. Januar 2020
Tierkadaver spielen eine wichtige Rolle für die Artenvielfalt und das Funktionieren von Ökosystemen – auch über längere Zeiträume. Diese Erkenntnisse haben Wissenschaftler des Deutschen
Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Reichsuniversität Groningen in der Zeitschrift PLOS ONE veröffentlicht. Die Kadaver bieten nicht nur vielen
aasfressenden Tierarten Nahrung, ihre Nährstoffe tragen auch zu einem wesentlich stärkten Wachstum umliegender Pflanzen bei. Dies begünstigt wiederum viele pflanzenfressende Insekten und deren
Räuber. Die Forscher empfehlen, rechtliche Regelungen, die die Beseitigung von Kadavern vorschreiben, für Naturschutzgebiete zu lockern.
Im niederländischen Wildnisreservat Oostvaardersplassen, einem der größten Feuchtgebiete Mitteleuropas, untersuchten die Wissenschaftler, wie sich Kadaver von Rothirschen auf die lokale Artenvielfalt auswirken. Dazu erfassten sie zum einen das Vorkommen von Insektenarten auf Flächen mit und ohne Kadaver, zum anderen das Pflanzenwachstum in unmittelbarer Nähe zum Kadaver. Dabei fanden sie, dass die Kadaver nicht nur vielen aasfressenden Insekten wie etwa Fliegen und Aaskäfern direkt zugutekommen, sie wirken sich langfristig auch positiv auf das Pflanzenwachstum aus.
Pflanzen wie die Krause Distel (Carduus crispus) wurden in der Nähe der Kadaver über fünfmal so groß wie an anderen Standorten, was wiederum die Zahl pflanzenfressender Insekten und ihrer Räuber auf das Vierfache erhöhte. “Dass Tierkadaver für Aasfresser wichtig sind, überrascht zunächst wenig”, sagt Untersuchungsleiter Dr. Roel van Klink. “Dass sie allerdings noch nach fünf Monaten einen solch großen Einfluss auf die gesamte Nahrungskette vor Ort haben, und dies selbst auf so nährstoffreichen Böden wie in den Oostvaardersplassen, hätte ich nicht erwartet.” Van Klink hatte die Studie an der Reichsuniversität Groningen mit Kollegen durchgeführt. Heute ist er Postdoktorand am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv).
Die Ergebnisse werfen ein neues Licht auf die Rolle von Tierkadavern im Ökosystem. “Totholz in unseren Wäldern ist von der Bevölkerung mittlerweile weitgehend akzeptiert, was vielen Arten zugutekommt”, sagt Prof. Chris Smit von der Universität Groningen. “Der Anblick toter Tiere in der Natur ist jedoch oft noch ein gesellschaftliches Tabu. Das ist schade angesichts ihrer Bedeutung für die Ökosysteme und Biodiversität.” Außerdem erschweren EU-Gesetze, die Kadaver großer Tiere in Naturschutzgebieten zu belassen. Die Autoren empfehlen, diese Regelungen für Naturschutzgebiete zu lockern.
Erneut bestätigter Hinweis auf Braunbären in Bayern17.02.2020
Am vergangenen Wochenende hat ein Braunbär im Grenzgebiet zwischen Bayern und Tirol Trittsiegel im Schnee hinterlassen. Die Spuren im südlichen Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurden von einem Mitglied des Netzwerks Große Beutegreifer gemeldet. Letztes Jahr gab es von Juni bis Oktober mehrfach Nachweise eines Braunbären im Gebiet zwischen Reutte (Tirol) und dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Es ist möglich, dass alle Spuren von einem einzigen Tier stammen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Bären ihre Winterruhe kurzzeitig unterbrechen. Der Bär verhält sich nach wie vor sehr scheu und unauffällig. Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern wurden informiert. Bayern ist mit einem Managementplan auf diese Situation vorbereitet. +++ Verhaltensregeln und häufig gestellte Fragen (FAQs) finden Sie auf den Internetseiten des LfU unter: https://www.lfu.bayern.de/ So ist es bei Aufenthalten in der Natur z.B. auf einem Wanderausflug wichtig, sehr genau darauf zu achten, in der Natur keine Essensreste und keinen Müll zurückzulassen. Die nächste Bärenpopulation befindet sich im italienischen Trentino, etwa 120 km von Bayern entfernt. Dort leben zurzeit etwa 60 Bären, mit leicht steigender Tendenz. Eine Bärenpopulation breitet sich nur sehr langsam aus. Es wird nicht davon ausgegangen, dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln. Vor allem halbwüchsige Bärenmännchen bewältigen auf der Suche nach einem eigenen Territorium oft weite Strecken. Aus dem Kerngebiet nördlich des Gardasees wandern immer wieder einzelne Tiere in den nördlichen Alpenraum, wie 2016 nach Graubünden und Tirol oder 2006 nach Tirol und Bayern. Finden sie keine Partnerin, kehren sie in der Regel wieder an ihren Ursprungsort zurück. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nachweis eines Braunbären durch Trittsiegel im Schnee; Quelle: Bayerisches Landesamt für Umwelt |
|
 |
|
Hyalomma und Braune Hundeze
|
EU-Biodiversitätsstrategie nach 2020: Für eine Rückkehr zur Natur
Die großflächige Wiederherstellung von Naturlandschaften kann sowohl die aktuelle Klima- als auch die Biodiversitätskrise bekämpfen.
21.01.2020
Basiert auf einer Medienmitteilung von Rewilding Europe
Die großflächige Wiederherstellung von Naturlandschaften kann sowohl die aktuelle Klima- als auch die Biodiversitätskrise bekämpfen. Ein heute von sechs Institutionen herausgegebenes Strategiepapier, an dem auch das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) beteiligt sind, fordert von der Europäischen Kommission eine stärkere Priorisierung sogenannter Rewilding-Maßnahmen in der neuen EU-Biodiversitätsstrategie nach 2020. Rewilding bezeichnet die Wiederherstellung der Natur mit geringen menschlichen Eingriffen.
Der Natur zu helfen, hilft auch uns
Wir stehen aktuell zwei Umweltproblemen gegenüber: Dem Rückgang der biologischen Vielfalt (Biodiversität) und dem Klimawandel. Auch wenn sie häufig getrennt betrachtet werden – die beiden zugrunde liegenden Ursachen haben oft mit einer nicht nachhaltigen Entwicklung zu tun. Zur Wiederherstellung der Natur können sogenannte Rewilding-Maßnahmen und die Stärkung naturbasierter Lösungen beitragen – mit ihnen können beide Umweltprobleme gleichzeitig bekämpft werden.
Für diese Doppelstrategie plädieren Experten des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), des Europäischen Umweltbüros (EBB), World Wide Fund for Nature (WWF), BirdLife Europe & Central Asia und Rewilding Europe. In einem heute veröffentlichten Strategiepapier rufen sie die Europäische Kommission auf, Rewilding mit hoher Priorität in die EU-Biodiversitätsstrategie nach 2020 aufzunehmen. Mit ehrgeizigen Zielen für die Wiederherstellung der Natur und die entsprechende Gesetzgebung könnte die Strategie zu einer großflächigen Erholung der Natur in Europa führen. Damit würde sie helfen, die Klima- und die Biodiversitätskrise zu bekämpfen und die entsprechenden Ziele der EU zu erreichen. „Eine großflächige Wiederherstellung der Natur in Europa würde nicht nur den Rückgang der Biodiversität stoppen und umkehren. Die Natur würde zusätzlich der Atmosphäre Kohlenstoff entziehen und damit den Klimawandel bremsen“, sagt Prof. Henrique Pereira, Leiter der Forschungsgruppe Biodiversität und Naturschutz bei iDiv und MLU. „Die neue Biodiversitätsstrategie nach 2020 sollte deshalb rechtlich bindende Ziele für die Wiederherstellung zerstörter Lebensräume mit Rewilding-Maßnahmen beeinhalten.“
Wiederherstellung geschädigter Ökosysteme
Die Wiederherstellung von Wäldern könnte bis zu zwei Drittel der angesammelten CO2-Emissionen der Atmosphäre binden und damit maßgeblich beitragen, die globale Erwärmung auf weniger als 1,5 °C zu begrenzen. Solche Maßnahmen können jedoch nur erfolgreich sein, wenn sie auf die Wiederherstellung natürlicher, biologisch komplexer und selbsterhaltender Wälder abzielen. Monokulturen schädigen hingegen häufig die vorhandene Biodiversität und machen den Wald anfälliger für Brände und Krankheiten.
Auch die Wiederherstellung von Torfmooren kann eine kostengünstige Möglichkeit sein, den Klimawandel abzuschwächen. Funktionsfähige Torfmoore speichern Kohlenstoff auf der Atmosphäre. Doch ein Großteil der europäischen Moore ist geschädigt: Durch Trockenlegung, Abbau, Forstwirtschaft oder Abbrennen. Das Austrocknen der Moore setzt Kohlenstoff frei. Torfmoore wiederherzustellen bedeutet deshalb auch, ihre Funktion als Kohlenstoffspeicher wiederherzustellen.
Kostengünstige Veränderungen
Das Strategiepapier fordert, in der EU-Biodiversitätsstrategie nach 2020 verbindliche Ziele für die Wiederherstellung der Natur festzulegen. Dies würde natürliche Waldgebiete, Torfmoore, Aulandschaften, Feuchtgebiete und artenreiche Wiesen sowie Küsten- und Meeresgebiete einschließen. Wiederaufforstungen sollten mit heimischen Baumarten erfolgen während sich andernorts Wälder ohne Neupflanzungen erholen können. Die Kosten großflächiger Maßnahmen zur Wiederherstellung von Ökosystemen sind oftmals sehr hoch – ein Grund, weshalb die EU die gesetzten Ziele aktuell nicht erreicht. Das Strategiepapier zeigt, dass selbsterhaltende und funktionsfähige Ökosysteme nur wenig menschliche Unterstützung benötigen und so die Kosten für die Schaffung ökologischer Netzwerke reduzieren können.
Die Wiederherstellung der Natur kann – zeitnah und kosteneffektiv – viele Vorteile haben: die Reduktion von Kohlenstoff in der Atmosphäre, Schutz vor Überflutungen und Küstenerosion, stabilere Ernten, geringeres Waldbrandrisiko, sauberes Trinkwasser, menschliches Wohlbefinden und Gesundheit sowie wirtschaftliches Wachstum. Mit Rewilding-Maßnahmen kann die EU-Biodiversitätsstrategie nach 2020 dazu beitragen, dass all dies erreicht wird.
EU-Biodiversitätsstrategie
Die EU-Biodiversitätsstrategie wurde 2011 von der Europäischen Kommission verabschiedet, um den Rückgang der Biodiversität und naturbasierter Lösungen in der EU zu stoppen. Während die Strategie bis 2020 auf eine Wiederherstellung von mindestens 15 % der geschädigten Ökosysteme abzielte, zeigte ein Zwischenbericht im Jahr 2015, dass zur Erreichung dieses Ziels kaum Fortschritte gemacht wurden.
Originalpublikation
Henrique M. Pereira, Néstor Fernandez, Andrea Perino, Josiane Segar, Frans Schepers, Rob Stoneman (2020). Ecological restoration in the EU post-2020 biodiversity strategy: The opportunities of rewilding European landscapes for nature and climate.
Brot-Aroma: Moderne und alte Weizensorten schmecken gleich gut
11. Dezember 2019
Moderne Weizensorten liefern grundsätzlich ähnlich aromatische Brote wie die alten Sorten. Unterschiede bestehen zwischen einzelnen Sorten – und den Anbaugebieten. Das fand ein Team aus deutschen und
Schweizer Forschern unter Federführung der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Hohenheim in Stuttgart heraus. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verglichen
Geschmack und Geruch von Broten, die in enger Kooperation mit je einem handwerklichen Bäcker und Müller mit Mehl aus alten und aus modernen Weizensorten gebacken wurden. Außerdem beschreibt das
Forschungsteam nun im Journal Food Research International, wie es den Geschmack und andere Broteigenschaften molekularbiologisch vorhersagen kann.
Weizen gehört zu den für die Ernährung der Weltbevölkerung wichtigsten Nahrungspflanzen. In den letzten Jahrzehnten züchtete man neue Sorten, die nicht nur deutlich ertragreicher sind als alte
Sorten, sondern auch unempfindlicher gegen Schädlinge und sich ändernde klimatische Gegebenheiten. Darüber hinaus konnten auch die Backeigenschaften verbessert werden.
Bei der Züchtung, aber auch beim Anbau und Handel von Weizen, stand bisher nicht das Aroma des aus dem Weizenmehl gebackenen Brotes – sein Geruch und Geschmack – im Vordergrund. Dies liegt unter
anderem auch daran, dass es sehr aufwändig ist, das Aroma zu erfassen. Eine umfassende Studie hat nun das Aromapotenzial verschiedener alter (Sortenzulassung vor 2000) und moderner Weizensorten in
den Blick genommen und für die Aromavorhersage molekularbiologische Methoden eingesetzt.
Die Studie zeigt, wie Wissenschaft entlang der Wertschöpfungskette gelingt: Beteiligt waren neben verschiedenen Instituten der HHU und der Universität Hohenheim auch die Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften, das Max-Planck-Institut (MPI) für Molekulare Pflanzenphysiologie in Golm sowie die Bäckerei Beck in Römerstein, die Stelzenmühle in Bad Wurzach und das
Kreislandwirtschaftsamt in Münsingen.
80 Brote für die Wissenschaft
Um die Aromen zu vergleichen, stellte das Forschungsteam mit den Mehlen aus insgesamt 40 Sorten nach gleichem Rezept Teige her und backte daraus Brote. Um festzustellen, ob mögliche Aromaunterschiede
auf die Weizensorte oder auf die Standorte, an denen der Weizen gewachsen ist, zurückzuführen sind, wurde für jede Sorte zwei Brote gebacken: eines mit Weizen, der in Gatersleben gewachsen ist, und
eines mit Weizen aus Stuttgart-Hohenheim.
Die Teige und die Brote wurden zunächst nach äußeren Parametern verglichen (Teigelastizität, Brotgröße). Anschließend beurteilten Testpersonen den Geruch und den Geschmack der Brote nach einem
festgelegten Schema. Zunächst beschrieben die Tester generell, wie aromatisch – oder fade – ein Brot schmeckt. Anschließend charakterisierten sie mit Hilfe des sogenannten „Wäderswiler Aromarades“
das Brotaroma genauer.
Aroma-Unterschiede je nach Sorte und Anbauort
„Mir wird oft gesagt, moderne Sorten würden doch fadere Brote liefern als alte Sorten“, erklärt apl. Prof. Dr. Friedrich Longin von der Universität Hohenheim. „Das konnten wir widerlegen. Es gab
sowohl bei den alten als auch bei den modernen Sorten solche, die sehr wohlschmeckende Brote lieferten. Es ist faszinierend, wie sich die Brote je nach Weizensorte geschmacklich und im Geruch
unterscheiden.“
Der Bäckermeister Heiner Beck aus Römerstein hat alle Brote verbacken und mitprobiert: „Ich habe schon viele Brote aus verschiedenen Weizensorten hergestellt und getestet. Aber ich bin überrascht,
wie sich die Brote aus den verschiedenen Sorten in Form, Aroma und sogar Farbe unterscheiden.“
Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis: Der Boden, auf dem der Weizen wuchs, hat oft einen ähnlich großen Einfluss auf das Backergebnis und den Brotgeschmack wie die Weizensorte. Hierin spiegeln sich
die unterschiedliche Bodenbeschaffenheit sowie Nähr- und Mineralstoffgehalte der Standorte wider, die die Inhaltsstoffe in den Weizenkörnern beeinflussen.
Molekularbiologische Verfahren ermöglichen Vorhersage der Brotqualität
„Ein wesentlicher Aspekt unserer Studie ist, dass wir Methoden gefunden haben, mit denen man die Qualität des Brotes anhand einiger molekularer Marker und des Stoffwechselprofils der Mehle
vorhersagen kann“, betont Prof. Dr. Benjamin Stich vom HHU-Institut für Quantitative Genetik und Genomik der Pflanzen. Die HHU-Forscher bestimmten gemeinsam mit dem MPI die Stoffwechselprodukte, die
sich im Mehl fanden, und führten die statistische Analyse zur Vorhersage der Broteigenschaften durch.
Die neue Methode hat einen entscheidenden Vorteil für die Pflanzenzüchtung: Um eine neue Weizensorte für den Markt zu züchten, werden regelmäßig sehr große Zahlen von Pflanzen – mehrere Tausend pro
Jahr – erzeugt, die alle auf ihre Eigenschaften hin untersucht werden müssen. „Es wäre viel zu aufwändig, aus dem Mehl all dieser Pflanzen Brote zu backen und diese zu verkosten“, so Stich. Mit dem
neuen Verfahren kann der Züchter zumindest sehr schnell solche Pflanzen erkennen, die Brote mit besserer Qualität liefern. Solche Pflanzen kann er dann in die engere Auswahl ziehen und im Testbacken
final überprüfen.
Originalpublikation Friedrich Longin, Heiner Beck, Hermann Gütler, Wendelin Heilig, Michael Kleinert, Matthias Rapp, Norman Philipp, Alexander Erban,
Dominik Brilhaus, Tabea Mettler-Altmann and Benjamin Stich, Aroma and quality of breads baked from old and modern wheat varieties and their prediction from genomic and flour-based metabolite
profiles, Food Research International, 9 December 2019, 108748, DOI: https://doi.org/10.1016/j.
Auswirkungen von Pestiziden auf die Intelligenz von Bienen
30. Oktober 2019 / PM BN
Forschungsergebnisse von Prof. Menzel von der Freien Universität Berlin zeigen, dass der Orientierungssinn von Bienen durch Insektizide und auch Glyphosat stark beeinträchtigt werden kann – Der BUND Naturschutz fordert deshalb zum Schutz von Insekten die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber auf, endlich eine detaillierte Reduktionsstrategie für den Pestizideinsatz in der bayerischen Landwirtschaft vorzulegen.
Randolf Menzel, emeritierter Professor für Neurobiologie am Institut für Biologie der Freien Universität Berlin, forscht seit 2002 zu den Auswirkungen von Pestiziden auf das Lernverhalten, die
Gedächtnisbildung, die Sammelmotivation, die Navigation und die Tanzkommunikation von Bienen. Aktuell sind auch bayerische Imker in sein Forschungsprojekt einbezogen. Seine Forschungen an Honigbienen
haben gezeigt, dass nicht nur die hochgiftigen Insektenvernichtungsmittel aus der Gruppe der Neonicotinoide, sondern auch Glyphosat Gehirnprozesse der Bienen stört. „Unsere Laborversuche zeigen, dass
Thiacloprid die Gedächtnisbildung sowie den Gedächtnisabruf der Bienen beeinträchtigt und bereits bei sehr niedrigen Dosen zu massiven Verhaltensstörungen führt. Auf ihren Sammelflügen zur
Futterquelle finden die mit Thiacloprid behandelten Tiere deutlich seltener zu ihrem Bienenstock zurück. Auch ihre Sammelmotivation und Tanzaktivität verringert sich messbar, was die
Nahrungsversorgung der Bienenvölker und deren Entwicklung gefährdet“, so Menzel, und weiter: „Auch bei der Glyphosatanwendung in für die Landwirtschaft üblichen Anwendungsmengen wurden Störungen des
Orientierungssinns nachgewiesen.“
Zulassung von vier Neonikotinoidwirkstoffen im Freiland beendet
Menzels Forschungsergebnisse waren mitentscheidend für das auf europäischer Ebene inzwischen erreichte Zulassungsende von drei Insektengiften aus der Wirkstoffgruppe der Neonikotionoide (
Imidacloprid, Clothianidin und Thiamethoxam) zumindest im Freiland seit Dezember 2018. Die Zulassung von Thiacloprid läuft nach Angaben der EU-Kommission vom 22.10.2019 voraussichtlich im April 2020
aus. .Noch zugelassen ist jetzt der Neonikotinoidwirkstoff Acetamiprid.
Bayern braucht konkrete Ziele zur Pestizidreduktion in der Landwirtschaft
„Um den Einsatz giftiger, umwelt-und gesundheitsschädlicher Pestizide in der Landwirtschaft zu minimieren, muss Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber endlich konkret werden und einen
Handlungsplan vorlegen“, fordert der BN Vorsitzende Richard Mergner. „Ziel muss sein, den Herbizideinsatz bis 2025 zu beenden, und für die weitere Reduktion des Pflanzenschutzmitteleinsatzes einen
Maßnahmenkatalog zu formulieren und umzusetzen“, so Mergner.
Materialien
https://passau.bund-naturschutz.de/presse-und-neues/aktuell/vortrag-prof-dr-randolf-menzel-freie-universitaet-berlin.html
Was für die Imker nur ein Traum bleiben wird, ihre Honigbienen einmal auf der Suche zu den verschiedensten Nahrungsquellen zu begleiten, machte das Forscherteam um Prof. Menzel zur Wirklichkeit. Die
Wissenschaftler bestückten einzelne Honigbienen mit einem Transponder, um mit einem Radargerät deren Flugverhalten über eine größere Distanz zu beobachten. Auf diese Weise konnten sie beweisen, dass
die Bienen, ähnlich wie Menschen, bei der Navigation eine innere Landkarte benutzen, die sie sich erst durch Orientierungsflüge einprägen müssen. Anfangs ging Prof. Menzel noch davon aus, dass die
Honigbienen bei ihren Navigationsflügen überwiegend ein angeborenes Verhaltensmuster zeigen und sie wegen ihres kleinen Gehirns, das nicht größer als ein Stecknadelkopf ist, auch nicht besonders klug
sein können. Weitere Experimente machten jedoch deutlich, dass sich die Bienen durchaus veränderter Situationen schnell anpassen können, indem sie Regeln erkennen, sie anwenden und kombinieren und
letztlich Entscheidungen treffen.
Schadwirkung von Neonikotinoiden
Neonikotinoide gehören zu den meistgenutzten Pestiziden der Welt. Die Mittel töten aber nicht nur Blattläuse, Holzwürmer und andere Schädlinge, sondern setzen auch Bienen und Hummeln schwer zu: Sie
schwächen ihr Immunsystem, stören die Orientierung und beeinträchtigen die Fortpflanzung.
Thiacloprid gilt als endokriner Disruptor und ist somit erwiesenermaßen schädlich für den Hormonhaushalt von Mensch und Tier. Die nationalen Behörden der EU-Länder waren deshalb bereits zuvor
verpflichtet, den Einsatz alternativer Mitteln nach Möglichkeit vorzuschreiben. Im Januar wies die EuropäischeLebensmittelsicherheitsbehörde (EFSA) auf eine "bedenkliche" Konzentration des Giftes im
Grundwasser hin. Die Behörde bemängelte zudem, dass sie eine vollständige Risikobewertung des Giftes für Menschen und Tiere, vor allem für Bienen, wegen mangelnder Daten nicht habe abschließen
können.
https://www.efsa.europa.eu/de/press/news/180228
https://www.bvl.bund.de/DE/04_Pflanzenschutzmittel/06_Fachmeldungen/2013/2013_07_12_Fa_Aenderung_Neonicotinoide.html;jsessionid=
54F76F32926705E76CF39F9AD9F799BB.1_cid350?nn=1400938
BN Position Landwirtschaft, Forderungen zur Pestizidminimierung
https://www.bund-naturschutz.de/fileadmin/Bilder_und_Dokumente/Themen/Landwirtschaft/BN_Position_Landwirtschaft_Aufl2_Juni2017-kl.pdf
Seite 58-59
Forschungsbericht zum Projekt Bienen-Schwänzeltanz
https://www.dfg.de/dfg_magazin/veranstaltungen/ausstellungen/idee_erkenntnis/robobee/index.html
Auszüge aus dem Eckpunktepapier der Baden-Württembergischen Landesregierung zum gestarteten Volksbegehren „Rettet die Bienen“
https://www.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/191022_Eckpunktepapier_MLR_UM_Insektenschutz_und_mehr_Artenvielfalt.pdf
• den Aufbau landesweiter Musterbetriebe, die als Anschauungsbetriebe und best practice-Beispiele für die Funktionsfähigkeit der Reduzierung und zur Weiterentwicklung des integrierten
Pflanzenschutzes dienen.
• ein Coaching-Programm zur Vermittlung der Reduktionsmaßnahmen in der Fläche und Handlungsempfehlungen für die unterschiedlichen Kulturen
• verbesserte Prognosesysteme
• Pflanzenschutzreduktion soll größere Zeitanteile in der Ausbildung der landwirtschaftlichen Berufe sowie bei den Fortbildungsangeboten des Landes (insbesondere den für den
Pflanzenschutzmitteleinsatz nötigen Sachkundenachweis) erhalten.
Artikel in Biene und Natur 10/2018: „Wie Bienen lernen“
https://www.bcp.fu-berlin.de/biologie/arbeitsgruppen/neurobiologie/ag_menzel/publications/Res/Menzel-Lernen-neu_final.pdf
Wiesenbrüter-Bruterfolg 2019 erfreulich
30. Oktober 2019 / PM LRA Pfaffenhofen
Zwei der vier Brachvogel-Küken von dieser Saison aus dem Paartal auf Nahrungssuche. Foto: Jokisch
Seit Juli 2018 ist im Landkreis Pfaffenhofen Jana Jokisch als Gebietsbetreuerin für Wiesenbrüter tätig. Sie ist dafür zuständig, den Schutz der sensiblen Arten, wie z.B. Großer Brachvogel und Kiebitz, zu verbessern und deren Bruterfolg zu erhöhen. Dafür kartiert sie für die gesamte Brutzeit von Anfang März bis Mitte Juli den Bestand der Wiesenbrüter und notiert sich, wo die Tiere nach Nahrung suchen, wo sie ihre Bodennester bebrüten sowie ob und wie viele Jungtiere schlüpfen bzw. überleben. Dabei helfen ihr ehrenamtliche Wiesenbrüter-Schützer, denn die Gebiete im Landkreis Pfaffenhofen liegen weit auseinander und es gibt viel zu tun.
„Wir müssen genau zum richtigen Zeitpunkt die Nester der Kiebitze ausstecken, damit sie bei der Bodenbearbeitung des Ackers aufgrund ihrer guten Tarnung nicht überfahren werden“, so Jokisch. Auch die Zäunung der Brachvogelnester muss genau dann erfolgen, wenn das Brachvogelweibchen fertig mit dem Gelege sind. Zu früh darf man dabei auf keinen Fall stören, sonst ist der Bruttrieb der Elterntiere noch nicht groß genug und sie verlassen ihr Nest. Deswegen muss jeden Tag jemand vor Ort sein, um die Brachvogelnester rechtzeitig einzuzäunen und mit den Landwirten die Bewirtschaftung abzusprechen.
„Die Saison 2019 verlief für das erste Betreuungsjahr schon recht erfreulich. Die Gebietsbetreuerstelle musste erst einmal aufgebaut und Kontakte mit den Landwirten, Jägern und anderen Interessensgruppen der jeweiligen Gebiete geknüpft werden“, so Anita Engelniederhammer, Leiterin der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt. Im Landkreis Pfaffenhofen haben dieses Jahr 17 Brachvogelpaare versucht zu brüten. Einige mussten aufgrund von Fressfeinden oder zu großen Störungen schon früh ihre Gelege aufgeben. „Dieses Jahr sind fünf junge Brachvögel flügge geworden“, so Jokisch. Im Vergleich mit anderen bayerischen Wiesenbrütergebieten sei das keine schlechte Zahl.
„Aber wenn man bedenkt, dass 17 Paare des Brachvogels eigentlich bis zu 68 Eier legen könnten (maximal 4 Eier pro Brutpaar), sieht man, dass noch ein sehr großes Potential besteht, den Bruterfolg zu erhöhen.“ Dafür müsse sich aber einiges ändern und für den Brachvogel und andere Wiesenbrüter in unserer Landschaft wieder Platz geschaffen werden. Jana Jokisch: „Wir sollten froh sein, dass der Brachvogel noch so verlässlich zu uns kommt. Damit er sich aber auch erfolgreich fortpflanzen kann, müssen wir sofort handeln und seine Habitate wiederherstellen, sonst ist er aus unserer Landschaft bald verschwunden.“ Dafür müssen genügend extensiv bewirtschaftete, feuchte Wiesen vorhanden sein, die störungsarm und mit wenigen Gehölzen durchzogen sind. Nur so hat der Brachvogel einen optimalen Überblick über sein Brutgebiet. Beim Kiebitz sieht es ähnlich aus. Hier ist zwar der Bruterfolg noch etwas höher, aber man kann beobachten, wie sich die Koloniebrüter in die letzten guten Gebiete im Landkreis zurückziehen. Aus vielen früheren Kiebitz-Flächen ist er bereits verschwunden.
Für den Erhalt der Wiesenbrüter zählt die Gebietsbetreuerin auf die Hilfe der Landwirte und anderer Interessensgruppen, aber vor allem auf die Rücksicht jedes einzelnen Bewohners im Landkreis. Indem man sich in der sensiblen Brutzeit an das Anleingebot von Hunden hält und Wiesenflächen nicht betritt, kann jeder seinen Teil zum Wiesenbrüterschutz beitragen. Die Wiederherstellung und optimale Pflege der Wiesenbrüter-Habitate kann nur mit den Landwirten gemeinsam funktionieren. „Im Paartal in der Gemeinde Hohenwart und im Irschinger Moos klappt die Zusammenarbeit sehr gut. Hier haben bestimmte Landwirte selbst ein Auge auf die sensiblen Tiere“, so Jokisch. Nicht selten bekommt sie wichtige Informationen direkt von Flächenbewirtschaftern, denen Brachvogel und Kiebitz am Herzen liegen. Nicht zufällig sind auch genau in diesen beiden Gebieten die Brachvogel-Jungen flügge geworden und mit ihren Eltern Richtung Süden geflogen. Jokisch: „Es wäre toll, wenn derartige Erfolge auch in anderen Wiesenbrüter-Gebieten verwirklicht werden könnten. Die Landwirte im Paartal und Irschinger Moos gehen auf jeden Fall mit gutem Beispiel voran.“
Vielfalt der europäischen Regenwürmer größer als in den Tropen
26. Oktober 2019 / Forschungsgruppe Experimentelle Interaktionsökologie
Deutsches Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung
An einem Ort der gemäßigten Breiten gibt es meist mehr Regenwürmer und mehr Regenwurmarten als an einem Ort gleicher Größe in den Tropen. Der Klimawandel könnte das Vorkommen von Regenwürmern und ihre Funktionen für Ökosysteme weltweit verändern. Für die Studie hat ein Wissenschaftlerteam unter Führung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig zusammen mit 140 internationalen Wissenschaftlern den weltweit größten Regenwurmdatensatz zusammengestellt – mit Informationen von 6928 Standorten aus 57 Ländern.
Fast überall auf der Welt gibt es Regenwürmer. Wo der Boden nicht dauerhaft gefroren, zu sauer, zu nass oder vollkommen trocken ist, fressen Regenwürmer organisches Material, graben Löcher und mischen Humus und Erde. Auf diese Weise fördern sie eine Vielfalt von Ökosystemleistungen des Bodens – machen Nährstoffe verfügbar, helfen klimawirksamen Kohlenstoff zu speichern oder Samen zu verbreiten. Regenwürmer gelten deshalb als „Ökosystem-Ingenieure“. Ihre Bedeutung spiegelt sich auch in ihrer großen Gesamt-Biomasse wider: Diese ist oft größer als die Gesamt-Biomasse aller am selben Ort lebenden Säugetiere.
Trotz der großen Bedeutung von Regenwürmern für Ökosysteme und Ökosystemleistungen für den Menschen, war bislang wenig bekannt über die weltweite Verbreitung von Regenwürmern. „Wissenschaftler haben bereits vor Jahrzehnten herausgefunden, dass an einem beliebigen Ort in den Tropen meist mehr Arten leben als an einem gleichgroßen Ort der gemäßigten Breiten“, sagt Erstautorin Dr. Helen Phillips, die am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Universität Leipzig arbeitet. „Doch für Regenwürmer konnten wir solche Untersuchungen bisher nicht durchführen, da es keine entsprechenden, globalen Datensätze gab.“
Phillips wollte eine Weltkarte erstellen, die so viele Daten wie möglich zur Vielfalt von Regenwürmern enthält: zur Anzahl der Arten, zur Anzahl der Individuen (Dichte) und zur Biomasse. Zusammen mit Kollegen einer Arbeitsgruppe des Synthesezentrums sDiv kontaktierte Phillips Regenwurmforscher aus der ganzen Welt und bat sie, ihre Daten für einen neuen, globalen Datensatz zur Verfügung zu stellen, der für jeden zugänglich sein sollte. „Erst dachten wir, das ist verrückt. Aber dann staunten wir, wie viele Kollegen ihre Daten mit uns teilen wollten“, meint Letztautor Prof. Nico Eisenhauer, Forschungsgruppenleiter bei iDiv und der Universität Leipzig. „Wir haben 2016 praktisch bei Null angefangen und konnten wenige Jahre später den weltweit größten Datensatz zur Bodenbiodiversität veröffentlichen. Das ist eine großartige Leistung der Erstautorin Helen Phillips und der vielen Wissenschaftler, die an uns geglaubt haben.“
Die Ergebnisse zeigen, dass Biodiversität unterirdisch anders verteilt ist als oberirdisch: Bei Pflanzen, Insekten und Vögeln zum Beispiel nimmt die Anzahl der Arten in einem bestimmten Gebiet zu, je mehr man sich dem Äquator nähert. Entsprechend finden sich oberirdisch die meisten Arten in den Tropen. Doch bei Regenwürmern ist es genau umgekehrt: Die meisten Regenwurmarten (kleinräumig betrachtet) fanden die Forscher an Orten in Europa, dem Nordosten der USA und Neuseeland. Ähnlich verhielt es sich mit der Dichte und der Biomasse. Auch hier waren die Werte in den gemäßigten Breiten am höchsten.
Gleichzeitig scheinen Regenwürmer in den Tropen kleinere Verbreitungsgebiete zu haben. Helen Phillips: „In den Tropen findet man alle paar Kilometer eine neue Gemeinschaft von Regenwurmarten. In kühleren Regionen hingegen bleibt diese mehr oder weniger gleich. Das könnte bedeuten, dass man in einem bestimmten Gebiet der Tropen zwar nur wenige Arten findet, die Gesamtzahl aller tropischen Regenwurmarten aber sehr hoch ist. Das wissen wir aber noch nicht.“ Diese Unsicherheit liegt vor allem daran, dass viele tropische Regenwurmarten noch gar nicht beschrieben wurden. Man weiß also oft nicht, ob Regenwürmer, die an verschiedenen Orten gefunden wurden, derselben Art oder verschiedenen Arten angehören.
Die Wissenschaftler untersuchten auch, welche Umweltfaktoren beeinflussen, wie viele Regenwürmer und Regenwurmarten an einem Ort leben. Das Ergebnis: Faktoren, die mit Niederschlag und Temperatur
zusammenhängen, hatten den größten Einfluss. „Der Klimawandel könnte zu starken Veränderungen bei den Regenwurmgemeinschaften und den von ihnen beeinflussten Ökosystemleistungen führen“, sagt Nico
Eisenhauer. „Aufgrund ihrer Rolle als Ökosystem-Ingenieure befürchten wir Auswirkungen auf andere Lebewesen wie Mikroorganismen, Bodeninsekten und Pflanzen.“
Die Ergebnisse der Studie sind auch für den Naturschutz wichtig: Biodiversität ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl schützenswerter Gebiete. Das Ausblenden unterirdischer Vielfalt kann dazu
führen, dass Regenwürmer nicht ausreichend geschützt werden – und damit auch ihr Beitrag zum Funktionieren der Ökosysteme. Entsprechend müsste auch die unterirdische Biodiversität berücksichtigt
werden, um die wahren Hotspots der Biodiversität zu identifizieren: „Es ist Zeit für einen Paradigmenwechsel beim Schutz der biologischen Vielfalt“, sagt Nico Eisenhauer. „Weil wir es nicht sehen,
vergessen wir allzu leicht das faszinierende Leben unter unseren Füßen. Regenwürmer mögen im Verborgenen weilen und nicht das Charisma eines Pandas haben. Aber sie sind extrem wichtig für andere
Lebewesen und das Funktionieren unserer Ökosysteme.“
Volker Hahn
Original-Publikation: Helen R. P. Phillips, Carlos A. Guerra, Marie L. C. Bartz, Maria J. I. Briones, George Brown, Thomas W. Crowther, Olga Ferlian,
Konstantin B. Gongalsky, Johan van den Hoogen, Julia Krebs, Alberto Orgiazzi, Devin Routh, Benjamin Schwarz, Elizabeth M. Bach, Joanne Bennett, Ulrich Brose, Thibaud
Decaëns, Birgitta König-Ries, Michel Loreau, Jérôme Mathieu, Christian Mulder, Wim H. van der Putten, Kelly S. Ramirez, Matthias C. Rillig, David Russell, Michiel Rutgers, Madhav P. Thakur,
Franciska T. de Vries, Diana H. Wall, David A. Wardle, Miwa Arai, Fredrick O. Ayuke, Geoff H. Baker, Robin Beauséjour, José C. Bedano, Klaus Birkhofer, Eric Blanchart, Bernd Blossey, Thomas Bolger,
Robert L. Bradley, Mac A. Callaham, Yvan Capowiez, Mark E. Caulfield, Amy Choi, Felicity V. Crotty, Andrea Dávalos, Darío J. Diaz Cosin, Anahí Dominguez, Andrés Esteban Duhour, Nick van Eekeren,
Christoph Emmerling, Liliana B. Falco, Rosa Fernández, Steven J. Fonte, Carlos Fragoso, André L. C. Franco, Martine Fugère, Abegail T. Fusilero, Shaieste Gholami, Michael J. Gundale, Mónica Gutiérrez
López, Davorka K. Hackenberger, Luis M. Hernández, Takuo Hishi, Andrew R. Holdsworth, Martin Holmstrup, Kristine N. Hopfensperger, Esperanza Huerta Lwanga, Veikko Huhta, Tunsisa T. Hurisso, Basil V.
Iannone III, Madalina Iordache, Monika Joschko, Nobuhiro Kaneko, Radoslava Kanianska, Aidan M. Keith, Courtland A. Kelly, Maria L. Kernecker, Jonatan Klaminder, Armand W. Koné, Yahya Kooch, Sanna T.
Kukkonen, Hmar Lalthanzara, Daniel R. Lammel, Iurii M. Lebedev, Yiqing Li, Juan B. Jesus Lidon, Noa K. Lincoln, Scott R. Loss, Raphael Marichal, Radim Matula, Jan Hendrik Moos, Gerardo Moreno,
Alejandro Morón-Ríos, Bart Muys, Johan Neirynck, Lindsey Norgrove, Marta Novo, Visa Nuutinen, Victoria Nuzzo, Mujeeb Rahman P, Johan Pansu, Shishir Paudel, Guénola Pérès, Lorenzo Pérez-Camacho, Raúl
Piñeiro, Jean-François Ponge, Muhammad Imtiaz Rashid, Salvador Rebollo, Javier Rodeiro- Iglesias, Miguel Á. Rodríguez, Alexander M. Roth, Guillaume X. Rousseau, Anna Rozen, Ehsan Sayad, Loes van
Schaik, Bryant C. Scharenbroch, Michael Schirrmann, Olaf Schmidt, Boris Schröder, Julia Seeber, Maxim P. Shashkov, Jaswinder Singh, Sandy M. Smith, Michael Steinwandter, José A. Talavera, Dolores
Trigo, Jiro Tsukamoto, Anne W. de Valença, Steven J. Vanek, Iñigo Virto, Adrian A. Wackett, Matthew W. Warren, Nathaniel H. Wehr, Joann K. Whalen, Michael B. Wironen, Volkmar Wolters, Irina V.
Zenkova, Weixin Zhang, Erin K. Cameron, Nico Eisenhauer (2019) Global distribution of earthworm diversity. Science, 366(6464):
Bär im Landkreis Garmisch-Partenkirchen
23. Oktober 2019
In der Nacht von gestrigen Dienstag auf heute wurde im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ein Braunbär von einer Wildtierkamera fotografiert. Bereits seit Juni dieses Jahres und zuletzt am 9. Oktober wurde in Tirol ein Bär nachgewiesen. Im Balderschwanger Tal wurde am 1. Oktober von einer Touristin eine Bärenlosung fotografiert. Es ist möglich, dass der aktuelle Fotonachweis die Wanderbewegungen des gleichen Tieres dokumentiert.
Der Bär verhält sich nach wie vor sehr scheu und unauffällig. Die nächste Bärenpopulation befindet sich im italienischen Trentino, etwa 120 km von Bayern entfernt. Dort leben zurzeit etwa 60 Bären, mit leicht steigender Tendenz. Eine Bärenpopulation breitet sich nur sehr langsam aus. Es ist nicht zu erwarten, dass Bären sich in Bayern dauerhaft ansiedeln.
Vor allem halbwüchsige Bärenmännchen bewältigen auf der Suche nach einem eigenen Territorium oft weite Strecken. Aus dem Kerngebiet nördlich des Gardasees wandern immer wieder einzelne Tiere in den nördlichen Alpenraum, wie 2016 nach Graubünden und Tirol oder 2006 nach Tirol und Bayern. Finden sie keine Partnerin, kehren sie wieder in ihre Heimat, das italienische Trentino, zurück.
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und BUND Naturschutz fordern echten Dialog
22. Oktober 2019
„Bauernproteste sind grundsätzlich berechtigt und werden dann auch etwas bewirken, wenn die Ursachen der Niedrigpreispolitik und des Zwangs zur Intensivproduktion angegangen werden, nämlich eine verfehlte agrarpolitische Weichenstellung auf EU Ebene, unterstützt von der deutschen und auch bayerischen Agrarpolitik. Sie werden jedoch verpuffen, wenn sie bei allgemeinen Aussagen ohne Forderungen bleiben und offensichtliche Auswirkungen der Intensivproduktion, wie Grundwasserbelastung und Artensterben, nicht angehen wollen“, bewertet Richard Mergner, BN Landesvorsitzender, die aktuellen Bauernproteste.
Josef Schmid, Vorsitzender der AbL in Bayern, „kritisiert die sehr undifferenzierten Aussagen der Bauerninitiative. Vorrangig wird gegen Reparaturversuche an einer seit Jahrzehnten verfehlten Agrarmarkt- und Förderpolitik protestiert, statt eine neue Agrarpolitik zu fordern. Eine, die nicht ständig durch neue Auflagen wie zum Beispiel Düngeverordnung oder Insektenschutzprogramm korrigiert werden muss und dabei trotz Wachstum und Strukturwandel keine Perspektiven für die übrig gebliebenen Höfe bietet. Ein Dialog mit der Gesellschaft kann nicht gelingen, solange notwendige Veränderungen als „Gängelung“ und „Schikane“ bezeichnet werden und Argumente von Nichtlandwirten als ideologische Meinungen abgebügelt werden.
Die höheren Kosten für diese Kursänderungen dürfen keinesfalls zu einer weiteren Intensivierung und weiterem Höfesterben führen. Sie können nur teilweise über eine zielgerichtete Agrarförderung und zusätzliche Investitionsförderungen getragen werden. Zusätzlich müssen auch Lebensmittelhersteller, Lebensmittelhandel und auch Verbraucher in die Pflicht genommen werden, um gemeinsam Wege aus der Billigproduktion zu finden“.
Veränderung der Arten-Zusammensetzung in Ökosystemen weltweit
21. Oktober 2019
An vielen Orten auf der ganzen Welt finden rasante Veränderungen der Biodiversität statt. Doch während sich die jeweiligen Arten in den lokalen Gemeinschaften stark verändern, bleibt die Zahl der Arten im Durchschnitt oft gleich. Daher spiegeln die Veränderungen auf lokaler Ebene nicht immer den globalen Artenverlust wider. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung, die von einem Forscherteam unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv), der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) und der Universität St. Andrews durchgeführt wurde. Die Studie wurde im Fachmagazin Science veröffentlicht und zeigt, dass sich die Zusammensetzung der Arten in marinen Ökosystemen stärker verändert als an Land. Dabei unterliegen insbesondere die marinen Tropen extremen Veränderungen.
Der Mensch hat einen starken Einfluss auf die biologische Vielfalt. Die Zahl der Arten nimmt weltweit ab, doch diesem Rückgang stehen sehr unterschiedliche Entwicklungen auf lokaler Ebene gegenüber. Internationale Wissenschaftler führender Universitäten aus Europa, den USA und Kanada haben nun die geografischen Unterschiede bei diesen Veränderungen genauer erforscht. Sie untersuchten, wie sich Artenreichtum (Anzahl der Arten) und Artenzusammensetzung (Identität der einzelnen Arten) mit der Zeit verändern. Dafür nutzten sie die Daten von weltweit über 50.000 Biodiversitäts-Zeitreihen, die sie der Datenbank BioTIME der Universität St. Andrews entnahmen. Sie analysierten auch, wo sich die biologische Vielfalt am stärksten verändert.
Frühere Untersuchungen, die keine Nettoveränderung des Artenreichtums auf lokaler Ebene zeigten, erwiesen sich als höchst kontrovers. Die Forschergruppe wollte daher einen Konsens darüber erzielen, wie sich die Biodiversität global verändert. Die Treffen der Wissenschaftler fanden im Synthesezentrum sDiv am Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) statt. „sDiv hat es geschafft, dass sich Menschen mit ganz verschiedenen Hintergründen zusammensetzen und eine gemeinsame Lösung finden“, meint Prof. Jonathan Chase, Leiter der Forschungsgruppe Biodiversitätssynthese bei iDiv und der MLU.
Die nun veröffentlichten Ergebnisse zeigen die geografischen Abweichungen in der Veränderung der biologischen Vielfalt: In allen Ökosystemen verändert sich die Artenzusammensetzung (Arten-Fluktuation). Besonders starke Veränderungen des Artenreichtums sowie der Artenzusammensetzung zeigen sich in den marinen Ökosystemen. Hier ist die maximale Fluktuation doppelt so hoch wie die auf dem Land. Dies liegt möglicherweise daran, dass marine Arten empfindlicher auf die globale Erwärmung reagieren.
In den marinen Tropen sind die Veränderungen der biologischen Vielfalt am stärksten – hier sind sowohl extreme Arten-Gewinne, -Verluste als auch -Fluktuationen zu verzeichnen. „Wenn sich an diesen Entwicklungen nichts ändert, könnte das zu einer dramatischen Umstrukturierung der biologischen Vielfalt führen. Das hätte möglicherweise weitreichende Konsequenzen für die Funktionsweise der Ökosysteme“, meint Erstautor Shane Blowes, der bei iDiv und der MLU forscht. Die Tropen beherbergen den Großteil der biologischen Vielfalt und gelten als die Region, in der die Biodiversität am stärksten gefährdet ist. Angesichts des Klimawandels gibt es wahrscheinlich wenige Arten, die jene ersetzen können, die in den Tropen verlorengehen.
„Wenn heute in den Nachrichten von Biodiversität die Rede ist, dann geht es meistens um die Waldbrände im Amazonas oder ein globales Artensterben in den Korallenriffen. Das ist natürlich auch richtig und solche Meldungen sind sehr besorgniserregend“, sagt Letztautorin Maria Dornelas von der Universität St. Andrews. „Aber mitunter erholen sich die Ökosysteme auch, oftmals im Verborgenen, und an vielen Orten passiert auch gar nichts.“ Die neue Studie zeigt, dass der Artenreichtum an einigen Orten abnimmt, an anderen zunimmt. Die Veränderung der Artenzusammensetzung ist jedoch ein flächendeckendes Phänomen. Herauszufinden, wo sich die Biodiversität verändert – und wie – ist wichtig, um Schutz- und Bewirtschaftungsstrategien entsprechend zu planen.
Das Wissen, wie und wo sich die biologische Vielfalt verändert, hilft , Prioritäten für den Naturschutz zu setzen – zu erkennen, welche Regionen besonderen Schutz brauchen und welche sich mit etwas Hilfe von selbst erholen. Doch auch wenn in diese Studie bereits eine große Datenmenge eingeflossen ist, so fehlt es in vielen Regionen wie der Tiefsee oder den Tropen noch an einem umfassenden Monitoring – der systematischen Erfassung von Biodiversität und ihrer Veränderung. Die Studie zeigt, wie wichtig es ist, die räumliche Abdeckung des Biodiversitäsmonitorings zu verbessern. Nur so können wir besser verstehen, wie sich die Biodiversität auf der ganzen Welt verändert, und nur so können wir wirksame Maßnahmen zu ihrem Schutz ergreifen.
Originalpublikation:
(iDiv-Wissenschaftler fett)
Shane A. Blowes und Sarah R. Supp, Laura H. Antão, Amanda Bates, Helge Bruelheide, Jonathan M. Chase, Faye Moyes, Anne Magurran, Brian McGill, Isla Myers-Smith, Marten Winter, Anne D. Bjorkman, Diana Bowler, Jarrett E.K. Byrnes, Andrew Gonzalez, Jes Hines, Forest Isbell, Holly Jones, Laetitia M. Navarro, Patrick Thompson, Mark Vellend, Conor Waldock, Maria Dornelas (2019), The geography of biodiversity change in marine and terrestrial assemblages. Science, 366, 339-345. DOI: https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aaw1620
Neues vom Bär
18. Oktober 2019
Bären-Losung identifiziert
Im Landkreis Oberallgäu wurde am 1. Oktober 2019 eine Losung fotografiert, die nach Einschätzung internationaler Bärenexperten von einem Bären stammt. Somit liegt aktuell ein C2-Hinweis vor.
Neues vom Wolf
16. Oktober 2019
Wolf im Landkreis Oberallgäu fotografiert
Am 12. Oktober 2019 wurde im südwestlichen Teil des Landkreises Oberallgäu ein wolfsartiges Tier von einer automatischen Fotofalle fotografiert. Experten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt haben auf dem Foto einen Wolf identifiziert. Das Tier weist wolfstypische Merkmale hinsichtlich Färbung und Proportionen auf, die es eindeutig von einem Hund unterscheiden.
10. Oktober 2019
Drei Mal Wolf
Im westlichen Landkreis Bad Kissingen wurde am 20.09.2019 erneut ein wolfsartiges Tier von einer Fotofalle erfasst. Experten des LfU und der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW) bewerten das Bild als Wolfsnachweis der Kategorie C1. Zwei weitere Fotofallennachweise aus der nahen Umgebung gab es am 03.09.2019 und 09.08.2019.
Im nördlichen Landkreis Main-Spessart wurden an einem Wildtierriss vom 29.06.2019 Proben für die genetische Analyse genommen. Das Ergebnis der Analyse durch das nationale Referenzlabor bestätigt einen Wolf aus der alpinen Population. Anhand der Proben waren weder eine Individualisierung noch eine Geschlechtsbestimmung möglich.
In Hessen wurde am 29.09.2019 eine tote Wölfin im Bereich des Forstamts Jossgrund/Main-Kinzig-Kreis aufgefunden. Zur Individualisierung des Tieres wurden genetische
Proben genommen. Nach den vorliegenden ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass es sich um einen Wildunfall handelt. https://www.hlnug.de/themen/
BSZ Katzenschutzverordnung Autor Alfred [...]
PDF-Dokument [7.8 MB]
Volksbegehren „Rettet die Bienen“:
Experten der Universität Hohenheim kritisieren Forderungen
02. Oktober 2019
Wissenschaftler beklagen falsche Prioritäten, Maximalforderungen und fehlenden Dialog. Das bayerische Volksbegehren „Rettet die Bienen“ war das erfolgreichste der Landesgeschichte
und soll nun 1:1 Gesetz werden. Seit vergangener Woche läuft auch in Baden-Württemberg ein Volksbegehren unter gleichem Namen. Doch die Forderungen zum Stopp des Insektensterbens gehen deutlich über
das bayerische Vorbild hinaus. Entsprechend größer ist auch der Widerstand der Landwirte. Experten der Universität Hohenheim stehen den Forderungen ebenfalls kritisch gegenüber. In Presse-Statements
äußern sich Professor Johannes Steidle, Tierökologe, Dr. Sabine Zikeli, Leiterin des Zentrums für ökologischen Landbau, Professor Ralf Vögele, Dekan der Fakultät Agrarwissenschaft und Direktor des
Instituts für Phytomedozin sowie Peter Rosenkranz, Leiter der Landesanstalt für Bienenkunde.
Das Volksbegehren „Artenschutz: Rettet die Bienen“ ist eine Initiative von „proBiene - Freies Institut für ökologische Bienenhaltung“ und wird von zahlreichen Verbänden wie BUND BW,
NABU BW, Demeter BW oder Naturland BW unterstützt.
Die Forderungen im Überblick:
- Der Anteil der ökologischen Landwirtschaft soll bis 2035 auf 50% erhöht werden
- In Naturschutzgebiete sollen Pestizide verboten werden
- Flächen auf denen Pestizide eingesetzt werden sollen sich bis 2025 halbieren
- Streuobstwiesen sollen geschützt werden
Statements
Prof. Dr. Johannes Steidle, Fachgebiet Tierökologe, Universität Hohenheim
„Meine Einschätzung zum Volksbegehren zusammengefasst: Sehr gut gemeint, aber schlecht gemacht.
Das Thema Insektensterben ist wirklich ernst, und es bleibt zu hoffen, dass die Politik schnell handelt. Ich bin dankbar, dass das Volksbegehren Aufmerksamkeit auf dieses wichtige Thema lenkt.
Dennoch werde ich den Text in der vorliegenden Form nicht unterschreiben.
Hauptkritikpunkt aus meiner Sicht: Die Forderungen sind zu sehr auf die Pestizide verengt. Sie sind sicherlich ein Faktor für das Artensterben. Aber sie zum Kern des Problems zu erklären, das gibt
die Datenlage nicht her.
Ein wirklich entscheidender Faktor wird im Volksbegehren hingegen quasi gar nicht berücksichtigt: Damit Insekten überleben können, benötigen sie Lebensräume: Fraßpflanzen, Pflanzen, an denen sie ihre
Eier ablegen können, Lücken im Boden, blühende Wildpflanzen, Hecken…
Monokulturen mit Nutzpflanzen sind für Insekten hingegen in etwa so attraktiv wie eine geteerte Fläche. Ob man auf dieser ‚geteerten Fläche‘ dann auch noch Pflanzenschutzmittel ausbringt oder nicht,
spielt letztendlich keine so große Rolle mehr.
Der erste Schritt wäre also etwas gegen die Strukturarmut unserer Landschaft zu unternehmen: Beispielsweise ein verpflichtender Grünstreifen am Rande großer Äcker. Ein wichtiger Ansatzpunkt ist auch
ein anderer Umgang mit Grünland, das in immerhin 50% der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland ausmacht. Es sollte erheblich seltener gemäht werden.
Mein zweiter Kritikpunkt ist das geforderte Pauschal-Verbot sämtlicher Pflanzenschutzmittel und Biozide in Schutzgebieten. So wie ich die entsprechenden Gesetzestexte verstehe fallen darunter auch
die biologische Schädlingsbekämpfung und andere umweltfreundliche Methoden, ohne die biologische Landwirtschaft nicht möglich wäre.
Beispielsweise setzen viele Winzer beim Kampf gegen den Sauerwurm und den Heuwurm auf eine biologische Verwirrungstaktik. Sie bringen im Weinberg Gerüche von Weibchen aus, damit die Männchen die
echten Weibchen nicht mehr finden. Eine erfolgreiche und bewährte Strategie, die dabei hilft, den Einsatz chemischer Gifte zu reduzieren. Diese Methode wäre auch verboten.
Im Nachhinein für jedes einzelne biologische Mittel eine Sondergenehmigung auf den Weg zu bringen halte ich für einen nicht leistbaren bürokratischen Aufwand.
Mein Eindruck ist: Das bayerische Volksbegehren war so erfolgreich, weil vorab ein intensiver Dialog mit allen betroffenen Gruppen stattgefunden hat. In Baden-Württemberg wurde diese
Auseinandersetzung hingegen offensichtlich versäumt.“
Dr. Sabine Zikeli, Leiterin des Zentrums für ökologischen Landbau, Universität Hohenheim
„Das Volksbegehren will den Ökolandbau massiv ausbauen. Ich bin jedoch überzeugt, dass die Forderungen, wenn sie 1:1 umgesetzt würden, der Branche keinen Gefallen täten. Im Gegenteil.
Der Text des Volksbegehrens suggeriert, dass im ökologischen Landbau keinerlei Pflanzenschutzmittel eingesetzt würden. Auf den ökologischen Ackerbau trifft dies weitgehend zu: Hier gibt es
alternative Strategien der Schädlingsbekämpfung: z.B. über die mechanische Bekämpfung von Beikräutern oder über die Fruchtfolge, um Pilzkrankheiten und Schädlinge zu vermeiden. Im Obst- und Weinbau
können jedoch weder Pilze noch Insekten auf diese Weise bekämpft werden. Auch beim Kartoffelanbau müssen Maßnahmen gegen den Kartoffelkäfer ergriffen werden.
Zwar kommen keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel zum Einsatz, dafür aber Kupfer, pflanzliche Präparate oder biologische Mittel, wie z.B. Viren, die auf bestimmte Insekten wirken. All
dies wäre gemäß den Forderungen des Volksbegehrens jedoch nicht mehr erlaubt.
Jeder Kleingärtner weiß aber, dass man unter unseren Klimabedingungen zwar Äpfel kultvieren kann, diese aber ohne biologische Schädlingsbekämpfung eben nicht immer schön aussehen, sondern
Schorfflecken zeigen oder von den Raupen des Apfelwicklers befallen sind. Wir müssten den Apfelanbau also in Landschaftsschutzgebieten einstellen oder die Apfelbäume einhausen, das heißt unter Folie
und Netz kultivieren. Ich vermute jedoch, dass die Initiatoren des Volksbegehrens keine großflächige Folien-Plantagen am Bodensee im Sinn hatten.
Auch der Plan, die biologische Landwirtschaft bis 2025 auf 25% und bis 2030 auf 50% zu erhöhen erscheint mir unrealistisch. Für die Erzeugnisse muss schließlich auch ein Markt da sein. Der Bio-Markt
wächst zwar, aber eben nicht so schnell. Die Konkurrenz unter den biologischen Landwirten würde also erheblich zunehmen, sodass der Ökolandbau an Attraktivität verlieren würde.
Nicht zuletzt lebt der ökologische Landbau davon, dass die Landwirte diesen Weg aus Überzeugung gehen. Würde man den Umstieg gewissermaßen erzwingen, ist von deutlich mehr schwarzen Schafen
auszugehen. Richtlinien müssten vermutlich noch viel schärfer kontrolliert werden und die Glaubwürdigkeit der Branche könnte in Gefahr geraten.
Zahlreiche wissenschaftliche Studien belegen, dass der ökologische Landbau im Vergleich zum konventionellen Landbau stärker zum Erhalt der Biodiversität beiträgt. Den Landwirten ist dies bewusst und
der Erhalt der Biodiversität vielen von ihnen ein sehr großes Anliegen.
Verbände wie Demeter BW oder Naturland BW unterstützen das Volksbegehren. Ich vermute allerdings, dass hier vor allem die Stimmen von Mitgliedern gehört wurden, die Ackerbau betreiben und die
Konsequenzen für Sonderkulturen nicht in vollem Umfang wahrgenommen wurden. Der Verband Bioland BW hat sich aus den genannten Gründen daher gegen das Volksbegehren ausgesprochen.“
Prof. Dr. Ralf Vögele, Dekan der Fakultät Agrarwissenschaft und Direktor des Instituts für Phytomedizin, Universität Hohenheim
„Der Grundgedanke des Volkbegehrens ist unterstützenswert. Aber leider schießt es weit über das Ziel hinaus und ist deshalb aus meiner Sicht in der vorliegenden Form nicht akzeptabel.
Ich bin überzeugt, dass wir den Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel erheblich reduzieren können. Dazu müssen wir intelligente Strategien entwickeln und es gibt ja bereits sehr
vielversprechende Ansätze. Eine pauschale Verteufelung bringt uns hingegen nicht weiter.
Man darf nicht vergessen: Würden wir von heute auf morgen auf Pflanzenschutzmittel verzichten, könnten wir die Weltbevölkerung nicht mehr ernähren. Für viele deutsche Betriebe würde es das Aus
bedeuten. Kartoffeln oder Äpfel müssten wir z.B. nahezu komplett aus dem Ausland importieren. Auch Weinbau wäre in Deutschland nicht mehr möglich.
Nicht außer Acht lassen darf man an dieser Stelle auch, dass eine Reduktion der einsetzbaren Pflanzenschutzmittel zu großen Resistenzproblemen führen kann. Eine Reduktion der Aufwandmenge kann sehr
schnell zur Unterschreitung des nötigen Schwellenwertes führen, was den Einsatz der Mittel wirkungslos macht. Eine Reduktion des Spektrums der Mittel führt dagegen aufgrund der Verwendung nur eines
Wirkstoffs gegebenenfalls schnell zur Entwicklung von Resistenzen bei den Erregern – ähnlich der derzeit beobachtbaren zunehmenden Antibiotika-Resistenz bei Krankenhauskeimen.
Ein vernünftiges und zukunftsweisendes Management des Pflanzenschutzmitteleinsatzes wäre hier also weitaus zielführender.
Große Chancen bietet beispielsweise die Digitalisierung. Neue Technologien helfen Landwirten dabei, Pflanzenschutzmittel immer gezielter ausbringen und somit die Menge zu reduzieren.
Sehr vielversprechend halte ich auch einen Ansatz, der versucht, Vorteile der konventionellen und der ökologischen Landwirtschaft miteinander zu vereinen und deren jeweiligen Nachteile so weit wie
möglich zu reduzieren. Ziel sind Anbausysteme, die auf chemische Pflanzenschutzmittel verzichten, nicht aber auf Mineraldünger. An der Universität Hohenheim koordinieren wir dazu das
5,3-Mio.-Euro-Verbundprojekt „NOcsPS“.
Viele Menschen haben heute offensichtlich eine romantisch verklärte Sicht auf die Landwirtschaft, aber keine Vorstellung von der Realität der Betriebe. Diese fühlen sich durch das Volksbegehren zu
Unrecht an den Pranger gestellt.
Der Wunsch nach Verzicht auf Pflanzenschutzmittel steht zudem in krassem Widerspruch zu dem tatsächlichen Verhalten der Verbraucher. Solange im Supermarkt ausschließlich optisch makelloses Obst und
Gemüse nachgefragt wird, wird die Reduktion von Pflanzenschutzmittel nur schwer gelingen.“
Dr. Peter Rosenkranz, Leiter der Landesanstalt für Bienenkunde, Universität Hohenheim
„Auch wenn der Imkerschaft der Insektenschutz naturgemäß sehr am Herzen liegt, sieht die Mehrheit die Maximalforderungen im Volksbegehren kritisch. Daher unterstützen derzeit weder der
württembergische noch der badische Imker-Landesverband, die zusammen ca. 25.000 Imker vertreten, das Volksbegehren.
Zahlreiche Obst- und Weinbauern insbesondere in Naturschutzgebieten der Bodenseeregion haben inzwischen deutlich gemacht, dass sie sich durch die Forderungen des Volksbegehrens in ihrer Existenz
bedroht sehen. Indirekt wäre davon auch die Imkerei betroffen.
Auch wenn es immer wieder Konflikte zwischen Landwirten und Imkern gibt, so sind beide Seiten doch stark aufeinander angewiesen. Denn Obst- und Gemüsebauern benötigen Bienen als Bestäuber und
umgekehrt sind die Sonderkulturen für die Imkerei wichtige Pollen- und Nektarquellen.
Die meisten Imker kennen die Sorgen und Nöte der Landwirte sehr gut, und wissen z.B., dass im Bereich der Sonderkulturen nicht komplett auf Pflanzschutz verzichtet werden kann. Zugleich haben Imker
natürlich ein starkes Interesse daran, dass ihre Bienenvölker gesund bleiben und der Honig nicht durch Pestizide verunreinigt wird.
In Bienenschutzausschüssen wird deshalb seit vielen Jahren auf lokaler Ebene intensiv darum gerungen, wie der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln reduziert und die Anbauflächen bienenfreundlicher
gestaltet werden können. Diese durchaus kontroversen Auseinandersetzungen und Diskussionen haben auch mit vielen konventionell arbeitenden Landwirten, die in diesem Volksbegehren leider weitgehend
außen vor bleiben, zu Verbesserungen beim Bienenschutz geführt.
Eine Unterstützung des Volksbegehrens durch die Imkerverbände würde diese Zusammenarbeit untergraben und gerade in den Obst- und Weinanbaugebieten alte Gräben wieder aufreißen.“
Urwaldkäfer kehrt nach 113 Jahren zurück
20. September 2019
Sensationsfund Peltis grossa ist 16. Urwaldreliktart

Eine echte Rarität: Peltis grossa.Der Flachkäfer kann bis zu zwei Zentimeter groß werden. Foto: Lukas Haselberger
Drei Punkte auf der Deutschlandkarte. Allesamt im Alpenraum. Doch bald kommt ein vierter Punkt hinzu – diesmal im Nationalpark Bayerischer Wald. Die Rede ist von der Verbreitungskarte eines äußerst seltenen Käfers. Wissenschaftlich heißt er Peltis grossa.
Ein deutscher Name fehlt der Flachkäferart aus der Familie der Jagdkäfer noch. 113 Jahre lang wurde er im Bayerwald nicht nachgewiesen. Da auch seit der Intensivierung der Käferforschung im Nationalpark vor 13 Jahren kein Exemplar gesichtet wurde, musste man davon ausgehen, dass die Art ausgestorben war. Nun der lang erwartete Erfolg: Nationalpark-Forschungsleiter Prof. Jörg Müller fand das bis zu zwei Zentimeter große Insekt an einem mächtigen Fichtenstumpf. Damit gibt es nun 16 Urwaldreliktkäfer im Nationalpark – so viele wie nirgendwo sonst in Bayern.
Es ist eine laue Spätsommernacht. Entomologe Lukas Cizek aus Budweis ist am Plöckenstein im tschechischen Nationalpark Šumava unterwegs. Er ist auf der Suche nach dem Zottenbock, ebenfalls ein Urwaldrelikt. Doch anstelle dessen findet er in der Nationalpark-Kernzone fast 20 Exemplare des Peltis grossa. Alle tummeln sich an Borkenkäferfichten, deren natürlicher Zerfall vom Rotrandigen Baumschwamm, einem Pilz, der Zellulose zersetzt, beschleunigt wird. Gegen 22:30 Uhr teilt er seinem bayerischen Kollegen Müller die Entdeckung via SMS mit. Der geht nicht ins Bett, sondern sucht potentielle Lebensräume in den Nationalparkwäldern auf. Zehn Minuten dauert es, bis Müller die Sensation gelingt. Auf einem Baumschwamm sitzt ein vitaler Peltis grossa. Zuletzt wurde diese Art im Bayerischen Wald im Jahr 1906 bei Spiegelau gesehen.
Käfer hat in einem Reservat auf tschechischer Seite überdauert
„Das Geheimnis des Erfolgs liegt in einem kleinen Reliktvorkommen in einem Reservat auf tschechischer Seite, rund 20 Kilometer hinter der Grenze,“ vermutet Müller. „Hier gab es in den 1990er Jahren noch Peltis-grossa-Funde“. Dies zeigt wie wichtig natürliche Spenderflächen für die Wiederbesiedlung sind.
Für große langfristig überlebensfähige Populationen braucht der Käfer vor allem eins: Viel Totholz mit Baumschwämmen. Das findet er mittlerweile in den Nationalparks Bayerischer Wald und Šumava auf großer Fläche – dank Borkenkäfer und Sturmereignissen. Nur deswegen gelang es dem Urwaldrelikt sich aus seinem kleinen urwaldartigen Refugium in die grenzüberschreitende Waldwildnis auszubreiten. Ohne die Philosophie Natur Natur sein lassen, wäre dies nicht möglich gewesen. „Große Schutzgebiete, die natürliche Prozesse zulassen, schaffen eben genau die Strukturen, die gefährdete Waldarten wie Peltis grossa dringend benötigen“, betont Müller.
Glückwünsche zur Wiederentdeckung kommen auch aus Tschechien. Pavel Hubený, Direktor des Nationalparks Šumava, freut sich nicht nur darüber, dass das Urwaldrelikt sich jüngst in seinem Schutzgebiet wieder ausgebreitet hat, sondern vor allem über den Sprung nach Bayern. „So wird die Nachricht zur grenzübergreifenden Erfolgsgeschichte, die einmal mehr zeigt, dass unsere geschützte Natur zusammen Großes bewegen kann.“
Seit 2015 der zweite wiederentdeckte Urwaldreliktkäfer
Für Nationalparkleiter Franz Leibl bestätigt dies ebenfalls den hohen Wert ungestörter Walddynamik auf großer Fläche. „Der Fund erinnert an die Geschichte der Zitronengelben Tramete. Auch dieser höchst gefährdete Pilz hat bei uns in naturnahen Waldreservaten überdauert und sich von dort aus in die Naturzonen des Nationalparks Bayerischer Wald ausgebreitet.“ Die Gemeinsamkeit mit dem wiederentdeckten Flachkäfer: Auch die Tramete benötigt große Mengen Totholz.
Der Fund beflügelt übrigens nicht nur die Naturschutzabteilung des Nationalparks, sondern auch das Umweltbildungsteam. Demnächst steht nämlich die Neuauflage des 2015 erschienenen Kinderbuchs „Die wilden 14“ an, in dem der Nationalpark als Herausgeber das Thema Urwaldreliktkäfer kindgerecht darstellt. Die neue Version des Buches wird dann jedoch den Titel „Die wilden 16“ tragen. Seit der Erstpublikation wurde neben Peltis grossa nämlich bereits 2017 der Gehörnter Zunderschwamm-Schwarzkäfer mit wissenschaftlichem Namen Neomida haemorrhoidalis im Nationalpark entdeckt.
Wilderei weiter bekämpfen und neue Luchsbestände etablieren
12. September 2019
Heute hat das Amtsgericht Cham einen 53-jährigen Jäger zu einer Zahlung von 3.000 Euro Geldstrafe verurteilt. Von dem Urteil geht dem Bund Naturschutz zufolge ein Signal aus, dass Wilderei von Luchsen in Bayern stärker geahndet wird fordert, noch mehr für eine „Luchsheimat Bayern“ zu tun: Es ist Zeit, Luchse in geeigneten Lebensräumen Bayerns wieder anzusiedeln“, so Martin Geilhufe, Landesbeauftragter des BUND Naturschutz vor dem Hintergrund des Urteils.
Auch wenn die Verurteilung heute ein Etappensieg für Luchs und Co. ist, darf nicht vergessen werden, dass der Bestand des Luchses mit nur etwa 130 erwachsenen Tieren in Deutschland immer noch keine langfristig überlebensfähige Größe erreicht hat.
In Bayern gibt es viele geeignete Luchslebensräume (Spessart, Rhön, Frankenwald, Oberpfälzer Wald mit Steinwald, Fichtelgebirge, Bayerisch-Böhmisches Grenzgebirge sowie die bayerischen Alpen mit Anbindungsmöglichkeiten an Luchsvorkommen in den West- und Ostalpen). Doch Jungluchse wandern meist nur 50 km weit ab und viele werden bei ihren Wanderungen überfahren. Deswegen ist eine Etablierung von Luchsbeständen in diesen Lebensräumen derzeit sehr unwahrscheinlich. Die zwei großen Luchsbestände Deutschlands (Bayerischer Wald und Harz) sind beide durch aktive Wiederansiedlung begründet worden.
Geilhufe fordert deswegen die Freisetzung von Luchsen in geeigneten Lebensräumen in den bayerischen Mittelgebirgen und den Alpen. Nur so könne das 2008 von der Bayerischen Staatsregierung im Managementplan Luchs definierte Ziel einer „vitalen Luchspopulation, die alle geeigneten Lebensräume Bayerns besiedelt“ erreicht werden. Auch andernorts in Deutschland, z.B. dem aktuellen Luchs-Wiederansiedlungsprojekt im Pfälzerwald, wird dieser Weg gegangen. „Mit einer Wiederansiedlung könnten wir der Gefahr eines erneuten Aussterbens des Luchses wirkungsvoll entgegen treten“, so Geilhufe.
Jungwölfe und toter Wolf im Veldensteiner Forst nachgewiesen
11. September 2019
Im Landkreis Bayreuth wurden am 08.09.2019 vier Jungwölfe von einer automatischen Videokamera aufgenommen. Es handelt sich um den zweiten Wurf des Wolfspaars im Veldensteiner Forst. Heutigen Mittwoch meldete die Polizeidienststelle Pegnitz dem Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) den Fund eines toten, wolfsähnlichen Tieres an der BT28 zwischen Pegnitz und Plech. Bei dem toten Tier handelt es sich um einen Wolf, wie die Dokumentationsstelle des Bundes zum Thema Wolf jetzt bestätigte.
Das LfU hat Untersuchungen zur Klärung der Todesursache und Individualisierung des Tieres in die Wege geleitet. Nach den vorliegenden ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass es sich um einen Wildunfall handelt. Behörden, Interessenverbände und Vertreter von Nutztierhaltern vor Ort wurden bereits informiert.
Der Veldensteiner Forst ist ein 6000 ha großes Waldgebiet, das südlich von Pegnitz überwiegend im Landkreis Bayreuth liegt. Im April 2017 wurde erstmals ein Wolf nachgewiesen; seit März 2018 lebt dort ein Wolfspaar. Im Sommer 2018 wurden vier Jungtiere beobachtet. In Bayern gibt es neben dem Rudel im Veldensteiner Forst weitere standorttreue Wölfe im Nationalpark Bayerischer Wald, auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr und in der Rhön.
Plantagen binden CO2 und bringen Regen in die Wüste
03. September 2019
Großflächige Plantagen in Wüstenregionen haben gleich mehrere Vorteile. An welchen Stellen sie am effektivsten dem Klimawandel entgegenwirken, das haben Erdsystemwissenschaftler und
Studienleiter Oliver Branch und Professor Volker Wulfmeyer von der Universität Hohenheim in Stuttgart mit einem neuen, globalen Index herausgefunden. Die wesentlichsten Effekte von
Plantagen bestehen darin, dass sie die mittlere Temperatur senken und Niederschlag auslösen können. Diese besondere Bio-Geoengineering-Methode ist in Bezug auf die Klimakrise interessant, da die
Plantagen so der Ausbreitung der Wüsten entgegenwirken können. Zum anderen binden die Pflanzen Kohlenstoffdioxid und helfen so dabei, Kohlenstoff zu speichern. Die Ergebnisse der Forscher sind jetzt
im renommierten Wissenschaftsmagazin „Proceedings of the National Academy of Sciences“ (PNAS) veröffentlicht: https://www.pnas.org/content/
„Großflächige Plantagen, z.B. aus Jojoba-Pflanzen, erhöhen deutlich den Anteil an Sonnenenergie, der von der Erdoberfläche absorbiert wird“, erklärt Branch. „Die Pflanzen geben die Energie dann
größtenteils in Form von Wärme an die Umgebungsluft ab“, erläutert der Forscher. So entstehe über der Wüste ein warmes Gebiet mit niedrigem Luftdruck, ein sogenanntes Hitzetief. „Die Druckdifferenzen
in der Umgebung der Plantagen erzeugen Auftriebsgebiete, die zur Bildung von Wolken und Niederschlag führen können.“
Mit den Plantagen kann also Regen in der Wüste erzeugt und das regionale Klima positiv beeinflusst werden. „Das globale Klima können wir natürlich erst verändern, wenn die CO2-Aufnahme
einen globalen Einfluss erreicht“, so Wulfmeyer, der das Projekt mitbetreut hat. „Aber schon so können wir das Wetter beeinflussen und das Leben in trockenen und heißen Gebieten für die Menschen
erträglicher gestalten.“
Global Feedback Index: Simulationen zeigen die geeignetsten Flächen
Die Stärke des Effekts hängt von der Region und der Jahreszeit ab. „Ob und wie gut die Bildung von Wolken und Niederschlag funktioniert, ist von vielen Faktoren abhängig“, erklärt Branch. So seien
beispielsweise die vorherrschenden Windgeschwindigkeiten und die Beschaffenheit des Bodens entscheidend.
Das kann dank einer neuartigen Methode nun erstmalig quantifiziert und so gezielt Maßnahmen zur Wiederaufforstung motiviert und kontrolliert werden: Branch entwickelte anhand von Simulationen den
sogenannten „Global Feedback Index“. Der Wert zwischen 0 und 3 gibt an, wie gut sich ein Gebiet eignet, um Plantagen zu Zwecken der Niederschlagsbildung anzubauen. „Drei ist hier der beste Wert“, so
Branch. „Gebiete, die diesen Wert erreichen, liegen zum Beispiel auf der Arabischen Halbinsel, in Namibia und in der Sahara. Für diese Landstriche planen wir weitere Simulationen.“
Auf der Grundlage von Wetterdaten der letzten 40 Jahre haben die Wissenschaftler Monatskarten für den ganzen Globus entwickelt. „Da es mit großem Aufwand verbunden ist, ein solches Projekt Realität
werden zu lassen, nutzen wir den Cray Supercomputer am HLRS, dem Höchstleistungsrechenzentrum der Universität Stuttgart. Dort führen wir hochaufgelöste Simulationen durch, um die geeignetsten Flächen
zu finden“, so Branch.
Anhand verschiedener Variablen lasse sich so zuverlässig feststellen, wo diese Methode zur Wolken- und Niederschlagsbildung funktionieren könne. Die Wissenschaftler sprechen von Bio-Geoengineering –
ein Begriff für Methoden, bei denen man mittels der Beeinflussung der Biosphäre das Klima auf der Erde bewusst optimieren möchte. „Jede Wüste ist unterschiedlich“, sagt Branch. „Während eine Plantage
von 100 km mal 100 km in Oman einen großen Unterschied machen und Wolken produzieren würde, können wir diesen Effekt beispielsweise für Israel ausschließen.“
Jojoba: eine Pflanze – viele Vorteile
Wichtig ist die Wahl der Pflanzen. Jojoba-Sträucher sind besonders geeignet, da sie beim Wachstum große Mengen von CO2 binden und hohe Temperaturen aushalten können. Damit tragen sie zu
sogenannten negativen Emissionen bei, also dem Rückholen von CO2 aus der Atmosphäre. „So können die Plantagen die Auswirkungen der Klimakrise eindämmen, während sie gleichzeitig seinem
weiteren Fortschreiten entgegenwirken“, fasst Dr. Branch zusammen. Außerdem transpirieren diese Pflanzen am Tage kaum, so dass der Hitzetief-Effekt besonders ausgeprägt ist.
Daneben böten die Plantagen weitere Vorteile für die Bevölkerung: „Aus Jojoba lässt sich beispielsweise ein hochwertiges, auf dem Markt stark nachgefragtes Öl herstellen“, so Branch. „Die
Sträucher können also auch wirtschaftlich genutzt werden.“ Die Biomasse könne als nachwachsender Rohstoff außerdem in der Energie-Gewinnung eingesetzt werden. „Da Jojoba eine anspruchslose Pflanze
ist, kann sie auch in Wüstenregionen gut gedeihen“, ergänzt der Wissenschaftler. „Sie benötigt nur wenig Wasser, und dieses muss auch keine Trinkwasserqualität haben.“
Publikation im Wissenschaftsmagazin PNAS
Die aktuelle Publikation zeigt, dass das Verständnis von komplexen Rückkopplungsprozessen inzwischen so weit gediehen ist, das regionale Wetter und Klima quantitativ steuern zu können. Deswegen
stellt diese Arbeit der Universität Hohenheim einen neuen Weg dar, mit Bio-Geoengineering einer der dringlichsten Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen: das Wetter und Klima zum Wohle der
Menschen zu beeinflussen.
Deliberate Enhancement of Rainfall using Desert Plantations
DOI: https://www.pnas.org/content/
Erster Verdachtsfall auf Fleckfieber-Übertragung in Deutschland
16. August 2019
Sie saugt am Menschen und sie überträgt auch in Deutschland eine Form des Zecken-Fleckfiebers: Was bisher noch offene Fragen zur tropischen Riesenzecke Hyalomma waren, ist nun Gewissheit: Anfang August ist hierzulande vermutlich erstmals ein Mann nach einem Stich der Hyalomma-Zecke erkrankt – mit den typischen Symptomen einer sogenannten Rickettsiose.
In der betreffenden Zecke konnten Experten der Universität Hohenheim in Stuttgart und des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr in München den Erreger Rickettsia aeschlimannii
nachweisen. Die Zahl der Hyalomma-Zecken in Deutschland ist 2019 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. In fast der Hälfte der Tiere sind die Fleckfieber-Erreger (Rickettsien) zu finden.
Die Zeckenforscher bitten die Bevölkerung weiterhin um Zusendung auffälliger Zeckenfunde. Dass es einen Pferdebesitzer traf, war wohl kein Zufall: Tropische Zecken der Gattung Hyalomma
saugen vor allem an großen Säugetieren. Seit einigen Jahren sind die Blutsauger in Deutschland auf dem Vormarsch. Nun melden Zeckenforscher den ersten Verdachtsfall einer in Deutschland übertragenen
Fleckfieber-Infektion. „Damit wissen wir jetzt nicht nur sicher, dass die Hyalomma-Zecke auch an Menschen geht“, so Professorin Ute Mackenstedt, Parasitologin an der Universität Hohenheim.
„Es besteht leider auch der dringende Verdacht, dass hier in Deutschland eine Übertragung des Zeckenfleckfiebers durch die Tiere tatsächlich möglich ist.“
Der Fall:
Ende Juli wurde der Pferdebesitzer aus der Nähe von Siegen von einer Hyalomma-Zecke gestochen. Die Übeltäterin schickte er an die Zeckenforscherin in Hohenheim. Nur wenige Tage später kam er mit schweren Krankheitssymptomen ins Krankenhaus. Der Verdacht: Zecken-Fleckfieber, verursacht vom Bakterium Rickettsia aeschlimannii. Die Zecke wurde per Kurierdienst an das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr (IMB) nach München gesandt, wo der Erreger in der Zecke nachgewiesen werden konnte. Darauf wurde der Patient gezielt mit dem Antibiotika behandelt, und die Symptome bildeten sich rasch zurück. „Dass wir von einem Verdachtsfall sprechen, liegt daran, dass ein Direktnachweis des Erregers am Patienten nicht möglich war“, erläutert Privatdozent Gerhard Dobler, Mediziner am IMB, „Die Behandlung des Patienten stand einfach an erster Stelle. Doch der unmittelbar vorausgegangene Zeckenstich, die typischen Symptome und vor allem der Nachweis des Erregers in der Zecke legen den Schluss nahe, als dass es sich bei dem Fall um Zecken-Fleckfieber handelte.“ Auch die Tatsache, dass die Antibiotikatherapie sofort anschlug, unterstreiche dies.
Zecken-Fleckfieber verursacht typischen Hautausschlag
Rickettsia aeschlimannii verursacht einen fieberhaften Infekt mit Kopf- und Muskelschmerzen, extremen Gelenkschmerzen und einem Gefühl, als würde man verbrennen. Typisch für die
Erkrankung ist jedoch der Hautausschlag, der dem Fleckfieber den Namen gab: Vor allem an den Extremitäten zeigt sich dieses klassische Zeichen. Die Inkubationszeit beträgt etwa eine Woche. „Bei
Verdacht auf Fleckfieber nach einem Hyalomma-Stich sollte an der Stichstelle ein Wundabstrich genommen und zur Untersuchung eingeschickt werden“, rät Dobler. „Wer unsicher ist, kann gerne
mit uns Kontakt aufnehmen. Ideal ist natürlich, wenn wir auch die Zecke untersuchen können.“
Zahl der Hyalomma-Zecken in Deutschland deutlich höher als im Vorjahr
Etwa die Hälfte der Hyalomma-Zecken, so die Forscher, sei mit Rickettsien infiziert. Die Übertragung erfolge ausschließlich über die Zecke. „Auch die Zahl der Hyalomma-Zecken in
Deutschland liegt in diesem Jahr deutlich höher als im Vorjahr“, berichtet Mackenstedt und verweist auf die Veröffentlichung, in der die Situation im Jahr 2018 dargestellt wurde.
(Chitimia-Dobler et al.: Imported Hyalomma ticks in Germany in 2018; Parasites & Vectors 134; 2019)
Die Hohenheimer Parasitologin kooperiert nicht nur eng mit dem IMB in München, sondern auch mit der Arbeitsgruppe von Professorin Christina Strube an der Tierärztlichen Hochschule (TiHo) Hannover.
„2019 haben wir zusammen bis jetzt schon 50 Exemplare in Deutschland gefunden. Letztes Jahr waren es insgesamt 35, davon 17 als Exemplare.“ Vergangenen Winter hatten die Tiere erstmals in Deutschland
überwintert. „Doch Rickettsien sind die einzigen Erreger, die wir bisher nachweisen konnten“, beruhigt PD Dr. Dobler. „Etwa das Virus, das das gefährliche Krim-Kongo-Hämorrhagische-Fieber
verursacht, oder die Krankheitserreger Theileria equi und Babesia caballi, die beide von Zecken auf Pferde übertragen werden können, haben wir bisher nicht gefunden.“
Forscher bitten Bevölkerung weiterhin um Mithilfe
Das Forschungsteam bittet nach wie vor die Bevölkerung um Unterstützung, um die Ausbreitung und mögliche Gefahren weiter zu erforschen. Wer eine festgebissene Zecke findet, sollte sie am besten wie
eine einheimische Zecke mit Zeckenzange, Zeckenkarte oder Pinzette entfernen. Anschließend bitte das Tier in einem kleinen, festverschlossenen Behälter schicken an:
Universität Hohenheim
Prof. Dr. Ute Mackenstedt
Fachgebiet für Parasitologie
Emil-Wolff-Straße 34
70599 Stuttgart
Mehr Infos: https://zecken.uni-hohenheim.
HINTERGRUND: Steckbrief Zecken-Gattung Hyalomma
Hyalomma marginatum und Hyalomma rufipes sind ursprünglich in den Trocken- und Halbtrockengebieten Afrikas, Asiens und Südeuropas beheimatet. In Mittel- und Nordeuropa kamen sie bis
vor kurzem nicht vor. Mit ihren gestreiften Beinen sind sie eine auffällige Erscheinung, viel größer als der normale einheimische Holzbock. Die erwachsenen Zecken saugen Blut vor allem an großen
Tieren. Sie sind aktive Jäger und bewegen sich rasch auf ihren Wirt zu. Dabei legen sie eine Strecke von bis zu 100 Metern zurück. Auch der Mensch ist ein potenzieller Wirt der Tiere. Larven und
Nymphen dagegen sind vor allem an Vögeln und Kleinsäugetieren zu finden. Sie bleiben bis zu 28 Tage auf ihrem Wirt und können so mit Zugvögeln nach Deutschland eingeschleppt werden. Im eurasischen
Raum gelten beide Hyalomma-Arten als Überträger des Virus des Krim-Kongo Hämorrhagischen-Fiebers und des Arabisch Hämorrhagischen Fiebers (Alkhumra-Virus). Sie übertragen auch das Bakterium
Rickettsia aeschlimannii, das eine Form des Zecken-Fleckfiebers auslöst.
Publikation
Chitimia-Dobler et al.: Imported Hyalomma ticks in Germany in 2018; Parasites & Vectors 134; 2019
https://parasitesandvectors.
Braune Hundezecke nischt sich in Deutschland ein
05.07.2019
Wohnungen sind geradezu ideal für die Braune Hundezecke, die eigentlich im Mittelmeerraum und Nordafrika heimisch ist und neuerdings auch in Deutschland. Mit einem Forschungsprojekt soll die Zeckenart jetzt genau untersucht werden: Von ihrer Häufigkeit, Verbreitung, über mögliche Krankheitserreger bis zur Frage, wie man sie eigentlich richtig loswird. Für die Forschung bittet die Universität Hohenheim, Funde der Braunen Hundezecke mit Bild zu melden.
Um die 25 Grad und trocken hat sie es am liebsten, lauert in kleinen, steinigen Spalten. Und wenn dann noch ein Hund in der Nähe ist, hat Rhipicephalus sanguineus den idealen Lebensraum für sich entdeckt. „Anders als unser Gemeiner Holzbock kann die Braune Hundezecke sehr gut in Wohnungen überleben“, sagt Katrin Fachet vom Fachgebiet Parasitologie der Uni Hohenheim. Nach Deutschland gebracht wird sie wohl mit Urlaubern, vermutet auch Professorin Ute Mackenstedt, Parasitologin und Expertin für Zecken an der Universität Hohenheim. „Wir können davon ausgehen, dass Besitzer, die mit ihren Hunden im Ausland im Urlaub waren, die Braune Hundezecke nach Deutschland bringen. Es wurden aber auch bereits Exemplare an Hunden gefunden, die ihren Hof nie verlassen hatten – ein Hinweis darauf, dass die Art hier möglicherweise bereits Fuß gefasst hat.“ Einmal eingenistet, so Fachet, könne die Braune Hundezecke sehr schnell zu einer sehr unangenehmen Plage werden. „Ein Holzbockweibchen kann bis zu 2.000 Eier legen – ein Hundezeckenweibchen bis zu 4.000. Innerhalb weniger Monate hat man dann schnell mehrere Tausend Zecken in der Wohnung.“ Das könnte auch gefährlich für den Menschen werden.
„Normalerweise befällt die Braune Hundezecke – wie es der Name schon sagt – fast ausschließlich Hunde. Ist die Population aber zu groß und der Wirt reicht nicht mehr aus, dann ist sie nicht wählerisch und sucht sich das Nächstbeste: Den Menschen.“ FSME oder Borreliose-Erreger wurde bisher nicht in dieser Zeckenart festgestellt. Dafür jedoch andere Krankheiten, so Fachet. „Die Braune Hundezecke kann zu schweren Erkrankungen der Hunde führen.“ Auch auf den Menschen übertragbare Krankheiten wie das Mittelmeer-Fleckfieber, ausgelöst durch Rickettsien, bringt sie mit sich.
„Wenn Sie annehmen, dass es in Ihrem Haushalt zu einem Befall mit den Braunen Hundezecken gekommen ist, sollten Sie sich mit einem Experten zu dieser Art in Verbindung setzen, der Sie beim weiteren Vorgehen beraten kann“, empfiehlt Katrin Fachet. „Werden in Eigeninitiative die falschen Maßnahmen ergriffen, kann es zu einer erheblichen Verschlimmerung des Befalls mit stark erhöhtem Gesundheitsrisiko für Mensch und Tier kommen.“ Die Wissenschaftlerin der Universität Hohenheim bittet daher die Bevölkerung um Hilfe bei ihrem Forschungsprojekt: „Wir wollen die betroffenen Fälle gerne betreuen – vom Anfang bis zum Ende des Befalls. Sollten Sie daher häufiger eine ungewöhnliche Anzahl an Braunen Zecken in einem Gebäude bemerken oder sollte Ihr Hund sehr stark von Zecken befallen sein, die der Braunen Hundezecke ähnlich sehen, dann schicken Sie bitte eine E-Mail mit Bild der Zecke an hundezecken@uni-hohenheim.de.“
Weiterhin ruft die Parasitologie der Universität Hohenheim auch dazu auf, gefangene Exemplare der auffälligen Hyalomma-Zecke einzusenden. Alle Informationen zur Hyalomma unter: https://zecken.uni-hohenheim.de/hyalomma und weitere Informationen sind unter http://hundezecken.uni-hohenheim.de zu haben.
(Alfred Raths)
Wo Menschen sind, laufen Tiere weniger weit
2019
Säugetiere bewegen sich in Gebieten,die stark vom Menschen geprägt sind, deutlich weniger als ihre Verwandten in der Wildnis. Sie legten nur zwischen der Hälfte und einem
Drittel der üblichen Strecken zurück. Das schreibt ein internationales
Team, unter Leitung von Forschenden des Senckenberg und der
Goethe-Universität, in der Titelgeschichte des Fachmagazins „Science“.
Die bisher umfassendste Studie zu diesem Thema basiert auf 57
Säugetierarten, deren Bewegungen per GPS verfolgt wurden. Die Autoren
weisen darauf hin, dass die von ihnen festgestellte Entwicklung
weitreichende Konsequenzen für die Ökosysteme und damit letztlich auch
für den Menschen haben könnte.
Ob Langstreckenläufer wie das Zebra oder Kurzstreckensprinter wie der
Hase: Alle Säugetiere überwinden täglich kleinere oder größere Strecken,
unter anderem auf der Suche nach Futter. Wie ein Team um die Biologin
Dr. Marlee Tucker, Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum
und Goethe-Universität, nun zeigen konnte, verringert sich der
Aktionsradius von Säugetieren jedoch in Gebieten, die stark durch den
Mensch geprägt sind, signifikant. Hier legen landlebende Säugetiere
durchschnittlich nur ein Drittel der Strecke zurück, die sie in der
unberührten Natur ablaufen.
Für ihre Untersuchung haben Tucker und 114 Koautoren in der bisher
umfassendsten Studie zu diesem Thema die Bewegungen von 803 einzelnen
Säugetieren rund um den Globus ausgewertet. „Wir haben insgesamt 57
Säugetierarten untersucht. Von Hasen über Wildschweine bis hin zu
Elefanten. Forscher im Team hatten jedes Tier mit einem Sender
ausgestattet. Per GPS konnten dann ihre Aufenthaltsorte für mindestens
zwei Monate stündlich verfolgt werden“, so Tucker.
Alle Daten von den weltweiten Standorten der Forscher wurden
schließlich im Portal „Movebank“ zusammengeführt, das die
Tierbewegungen archiviert. Die Daten verglichen die Wissenschaftler mit
dem „Human Footprint Index“ der Gebiete, in dem sich die Tiere
bewegten. Der Index gibt an, wie sehr das Gebiet durch den Menschen
verändert ist, beispielsweise durch den Bau von Siedlungen,
Verkehrswegen oder Landwirtschaft.
In Gebieten mit einem vergleichsweise hohen „Human Footprint Index“,
zum Beispiel einer typischen deutschen Ackerlandschaft, legen die dort
lebenden Säugetiere in zehn Tagen nur 33 bis 50 Prozent der Strecken
zurück, die andere Säugetiere durchschnittlich in der unberührten
Natur zurücklegen. Das gilt sowohl für die maximal in zehn Tagen
zurückgelegte Strecke als auch für die durchschnittlich in diesem
Zeitraum zurückgelegte Strecke. Die Auswertung zeigt darüber hinaus,
dass die Tiere nicht langsamer werden, sondern ihr langfristiges
Raumnutzungsverhalten so verändern, dass sie über längere Zeitskalen
weniger Strecke absolvieren.
Möglicherweise bewegen sich die Säugetiere weniger, weil sie ihr
Verhalten an die durch den Menschen stark beeinflusste Umgebung
angepasst haben. „In einigen dieser Gebiete gibt es teilweise ein
besseres Futterangebot, daher müssen die Tiere nicht mehr weite Strecken
auf sich nehmen, um satt zu werden. Außerdem schränken Straßen und die
Zerstückelung der Lebensräume vielerorts die Tiere in ihrer Bewegung
ein“, so der an der Studie beteiligte Juniorprofessor Prof. Thomas
Müller, Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum und
Goethe-Universität Frankfurt.
Die Forschenden sind besorgt, dass Ökosystemfunktionen, die an
Tierwanderungen gekoppelt sind, maßgeblich beeinträchtigt werden
könnten. „Dass Tiere bestimmte Distanzen überwinden ist wichtig, denn
damit transportieren sie beispielsweise Nährstoffe und Samen zwischen
verschiedenen Gebieten. Außerdem basieren viele natürliche Nahrungsnetze
auf Tierbewegungen. Wenn sich Tiere weniger bewegen, könnten sich viele
dieser Prozesse in Ökosystemen verändern. So könnte zum Beispiel der
Austausch von Pflanzensamen durch Tiere zwischen verschiedenen
Lebensräumen gefährdet werden“, sagt Tucker.
Kontakt
Dr. Marlee Tucker
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum &
Goethe-Universität
Tel +49 (0)69- 7542 1846
marlee.tucker@senckenberg.de
Jun.-Prof. Dr. Thomas Müller
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum &
Goethe-Universität
Tel. +49 (0)69- 7542 1889
Thomas.mueller@senckenberg.de
02. Juli 2019
Das Geheimnis der Pilzfarben
Fruchtkörper sind in kalten Klimazonen dunkler

Über 3000 Pilzarten wurden im Rahmen der Untersuchung analysiert, darunter: Elfenbeinschneckling (1. Reihe v.l.), Blutblättriger Hautkopf, Dunkler Rasenrötling, Safrangelber Saftlin (2. Reihe v.l.), Papageiensaftling, Violetter Lacktrichterling, Olivgelber Holzritterling (3. Reihe v.l.), Maronen-Röhrling, Fliegenpilz. (Fotos: Franz Krah, Peter Karasch/Nationalpark Bayerischer Wald)
Der Fliegenpilz ist mit seinem roten Hut wohl der auffälligste Vertreter unter den vielfältig und unterschiedlich intensiv gefärbten Pilzarten. Welchen Zweck diese Farben erfüllen, war bisher unbekannt. Forscher der Technischen Universität München (TUM) haben in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Bayerischer Wald erste Antworten auf dieses Rätsel gefunden.
In der Natur erfüllen bestimmte Farben und Muster meist einen Zweck: Der Feuersalamander signalisiert seinen Feinden mit seiner auffälligen Zeichnung, dass er giftig ist, eine rote Kirsche soll Vögel anlocken, die diese fressen und damit den Samen weiterverbreiten. Andere Tiere, wie das Chamäleon dagegen, schützen sich mit Tarnfarben vor der Entdeckung durch Fressfeinde.
Aber auch das Klima spielt bei der Färbung eine Rolle: Besonders Insekten oder Reptilien sind in kälteren Klimazonen dunkler gefärbt. Die wechselwarmen Tiere sind bei der Regulierung ihrer Körpertemperatur auf die Außentemperatur angewiesen. Durch die dunkle Färbung können sie die Wärme schneller aufnehmen. Derselbe Mechanismus könnte auch bei Pilzen eine Rolle spielen, vermuteten die Forscher um Franz Krah, der seine Doktorarbeit zu diesem Thema an der TUM verfasst hat und Dr. Claus Bässler, Mykologe an der TUM und Mitarbeiter im Nationalpark Bayerischer Wald. Denn auch Pilze könnten von der Sonnenenergie profitieren, um sich besser fortzupflanzen.
Verbreitung von 3054 Pilzarten untersucht
Um diese Theorie zu testen, werteten die Forscher Unmengen an Daten aus. Sie untersuchten die Verbreitung von 3054 Pilzarten in ganz Europa. Dabei analysierten sie deren Helligkeit und die in den Lebensräumen vorherrschenden klimatischen Bedingungen. Die Ergebnisse zeigen einen eindeutigen Zusammenhang: In kalten Klimazonen sind die Fruchtkörper der Pilze dunkler. Auch jahreszeitliche Veränderungen wurden berücksichtigt. So fanden die Wissenschaftler heraus, dass Pilzgemeinschaften, die tote Pflanzenbestandteile abbauen, im Frühjahr und Herbst ebenfalls dunkler sind als im Sommer.
„Natürlich ist das erst der Anfang“, erklärt Krah. „Es ist noch viel mehr Forschung nötig, bis wir ein generelles Verständnis für Pilzfarben entwickelt haben.“ So ist ein zusätzlicher jahreszeitlicher Färbungseffekt etwa bei Pilzen, die in Symbiose mit Bäumen leben, nicht nachzuweisen. „Dort spielen dann wohl noch weitere farbliche Funktionen, wie die Tarnung, eine Rolle.“ Auch muss noch untersucht werden, wie sehr die dunkle Färbung tatsächlich die Reproduktionsrate der Pilze beeinflusst.#
Neu eingewanderte Zecken-Art überwintert erstmals in Deutschland
Sie ist wieder da: In den letzten Tagen sind gleich sechs Exemplare der tropischen Hyalomma-Zecke in Deutschland aufgetaucht. Und dieses Jahr ist die Art einen wesentlichen Schritt weiter
auf dem Weg sich hier zu etablieren. Denn die Zeckenforscher der Universität Hohenheim in Stuttgart und des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr sind davon überzeugt, dass die Tiere – im
Gegensatz zu den Exemplaren des Vorjahres – in hiesigen Gefilden überwintert haben. Die auffälligen Tiere mit den geringelten Beinen sind doppelt bis dreimal so groß wie ihre europäischen
Verwandten.
Fünf Zecken in einem Pferdehof in Nordrhein-Westfalen, eine auf einem Pferd in Niedersachsen: „Wir haben die ersten Nachweise dieses Jahres von Hyalomma-Zecken in Deutschland“,
meldet Prof. Dr. Ute Mackenstedt von der Universität Hohenheim. „Und diesmal müssen wir davon ausgehen, dass diese Tiere bei uns in Deutschland überwintern konnten.“
Letztes Jahr wiesen die Zeckenforscher erstmals Tiere der Gattung Hyalomma in größerer Menge nach. Daraufhin hatte Prof. Dr. Mackenstedt gemeinsam mit PD Dr. Gerhard Dobler und Dr. Lidia
Chitimia-Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München im Februar die Bevölkerung gebeten, mögliche Funde von Hyalomma-Zecken einzusenden. Jetzt wurden sie fündig.
„Beide Funde sind in den letzten Tagen erfolgt, also praktisch zeitgleich“, erklärt PD Dr. Dobler. „Wir gehen deshalb davon aus, dass die drei heißen Tage dafür verantwortlich waren, dass die
wärmeliebenden Hyalomma-Zecken jetzt ziemlich gleichzeitig an unterschiedlichen Orten aktiv wurden.“
Hyalomma-Zecken können in Deutschland überwintern
Doch während die Exemplare letztes Jahr höchstwahrscheinlich noch mit Zugvögeln eingeschleppt wurden, dürfte das diesmal nicht der Fall sein. „Die Jugendstadien der Zecken, die Larven und Nymphen,
sind oft an Zugvögeln zu finden“, erläutert Prof. Dr. Mackenstedt. „Sie lassen sich dann einfach abfallen.“ Doch die jetzt gefundenen Tiere seien relativ früh im Jahr aufgetaucht. „Wenn man den
Entwicklungszyklus zurückrechnet, hätten sie also zu einem Zeitpunkt eingeschleppt werden müssen, als die Zugvögel noch gar nicht da waren.“
Letztes Jahr konnten zwei Hyalomma-Arten nachgewiesen werden, H. marginatum und H. rufipes. Bei den diesjährigen Zecken steht die genaue Artbestimmung teilweise noch aus,
„doch wir vermuten, dass es sich bei allen um H. marginatum handelt“, so Dr. Lidia Chitimia-Dobler. „Die Art stammt vorwiegend aus der Türkei und Osteuropa, weshalb sie unserem Klima eher
angepasst ist als H. rufipes aus Afrika.“
Forscher beobachten, ob sich Arten in Deutschland etablieren
Doch Überwintern heiße nicht notwendigerweise, dass Hyalomma in Deutschland bereits heimisch geworden ist. „Damit sich eine Population entwickeln kann, müssten sich Männchen und
Weibchen finden“, erklärt Prof. Dr. Mackenstedt. „Das ist bei geringer Populationsgröße schwierig. Zudem müssten sich Larven und Nymphen entwickeln, die Vögel oder auch Hasen als Wirt benötigen. Ob
und wie das hier funktioniert, wissen wir noch nicht. Das müssen wir weiter beobachten.“
Allerdings lege der Fund von fünf Hyalomma-Zecken in einem einzelnen Pferdehof nahe, dass dort mehrere Individuen gleichzeitig vorhanden waren und somit die Möglichkeit einer Paarung und des
Entstehens einer eigenständigen Population bestehe.
Auch andere tropische Zecken hat die Forscherin deshalb genau im Visier. Beispielsweise die Braune Hundezecke Rhipicephalus sanguineus: „Sie ist ursprünglich in Afrika beheimatet. Doch wir
gehen davon aus, dass diese Zecke mit Hunden nach Deutschland transportiert werden. Es wurden auch bereits Exemplare an Hunden gefunden, die ihren Hof nie verlassen hatten“, berichtet sie. „Damit
konnten sie kein unbeabsichtigtes Urlaubsmitbringsel sein – ein Hinweis darauf, dass sich die Art hier möglicherweise bereits entwickeln kann.“ Info-Seite zur Braunen Hundeze
target="_blank">https://hundezecken.uni-
HINTERGRUND: Steckbrief Zecken-Gattung Hyalomma
Hyalomma marginatum und Hyalomma rufipes sind ursprünglich in den Trocken- und Halbtrockengebieten Afrikas, Asiens und Südeuropas beheimatet. In Mittel- und Nordeuropa kamen sie bisher nicht vor. Mit ihren gestreiften Beinen sind sie eine auffällige Erscheinung, viel größer als der normale Holzbock.
Im eurasischen Raum gelten beide Arten als wichtige Überträger des Virus des Krim-Kongo Hämorrhagischen-Fiebers und des Arabisch Hämorrhagischen Fiebers (Alkhumra-Virus). Auch das Bakterium Rickettsia aeschlimannii, das eine Form des Zecken-Fleckfiebers auslöst, kann durch diese Zecken übertragen werden.
Die erwachsenen Zecken saugen Blut vor allem an großen Tieren. Die Zecken können sich aktiv auf ihren Wirt zubewegen und legen dabei eine Strecke von bis zu 100 Metern zurück. Auch der Mensch ist ein potenzieller Wirt der Tiere. Larven und Nymphen dagegen sind vor allem an Vögeln und Kleinsäugetieren zu finden. Sie bleiben bis zu 28 Tage auf ihrem Wirt und können so mit Zugvögeln nach Deutschland eingeschleppt werden.
Prof. Dr. Ute Mackenstedt, Universität Hohenheim, Leiterin des Fachgebiets Parasitologie
T 0711 459-22275, E Mackenstedt@uni-hohenheim.de
PD Dr. Gerhard Dobler, Dr. Lidia Chitimia-Dobler, Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr (IMB)
T 089 9926 923974, E GerhardDobler@bundeswehr.org
Uni Hohenheim entwickelt fälschungssichere Lebensmittel-Profile
18.06.2019
Uni Hohenheim arbeitet an neuen Methoden, um die Herkunft von pflanzlichen Nahrungsmitteln zu bestimmen
Chinesische Trüffel, die angeblich aus Frankreich kommen, angebliche Freiland-Tomaten, die aus dem Gewächshaus stammen: Falschangaben wie diese will jetzt ein Team der Universität Hohenheim in
Stuttgart mit neuen Analyse-Methoden wiederlegen. So sollen die Methoden exakte Angaben über die geographische Herkunft, die Anbaubedingungen und die Lebensmittelsorte ermöglichen.
„Der moderne Lebensmittelfälscher ist gebildet und studiert, er kennt die Szene und die Untersuchungsmethoden der Lebensmittelkontrolleure“, so charakterisiert Prof. Dr. Walter Vetter vom Institut
für Lebensmittelchemie den Fälscher von heute. Doch Handel und Verbraucher wollen Sicherheit. „Damit nimmt auch der Wunsch nach verlässlichen Daten über die Herkunft und Zusammensetzung von
Lebensmitteln zu.“ Für seine Forschung wählte das Team Trüffel und Walnüsse aus verschiedenen Ländern weltweit. „Voraussetzung für das Projekt war, dass wir uns wirklich auf die Herkunftsangaben der
Lieferanten verlassen konnten. Das ist uns bei Trüffeln und Walnüssen am besten gelungen“, erklärt Prof. Vetter. Ein weiterer Vorteil: „Trüffel sind fettarm, Walnüsse sind fettreich, so dass
wir mit diesen beiden eine große Bandbreite abdecken."
Chemische Details geben Auskunft über Herkunft pflanzlicher Lebensmittel
In dem wissenschaftlichen Verbundprojekt aus akademischen Partnerinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen erforscht das Projekt der Uni Hohenheim drei Methoden.
Die so genannte Isotopen-Analyse ermöglicht anhand der Bestimmung der Zusammensetzung der Kohlen- und Stickstoff- und Wasserstoffisotope in den Pflanzen genaue Angaben zur Herkunft einer Pflanze. In
Versuchen konnte das Team von Prof. Dr. Vetter damit beispielsweise den Unterschied von einer Freiland- und einer Gewächshauspaprika erkennen. „Mit einer weiteren Methode, der Lipid-Analyse, wollen
wir die Fettsäuren und Sterole (biochemisch wichtige Bestandteile der Zellmembran) der jeweiligen Lebensmittel genauer analysieren“, erläutert Prof. Dr. Vetter. Sterole sind im Fettanteil der
Pflanzen enthalten. Die Bestimmung des Sterol-Musters macht es so etwa möglich, einen kulinarisch wertlosen China-Trüffel von einem französischen Gourmet-Trüffel zu unterscheiden. Die dritte Methode
ist die so genannte Elementanalytik. Damit lassen sich die Mineralstoffe in den Pflanzen bestimmen. Sie geben Aufschluss darüber, auf welchem Boden die Pflanzen gewachsen sind, da die Mineralstoffe
beim Wachsen aus dem Boden auch in die Pflanze übergehen. So lässt sich anhand der Mineralstoffe nachweisen, wenn eine Pflanze nicht auf dem Boden einer bestimmten Region gewachsen ist und
beispielsweise sagen, ob sie wirklich aus der regionalen Landwirtschaft stammt oder nicht.
Nächstes Ziel: Methoden kombinieren und auf andere Lebensmittel ausweiten
Die größte Herausforderung in dem Projekt: „Gemeinsam mit unseren Forschungspartnern wollen wir die verschiedenen Methoden jetzt miteinander kombinieren.“ Interessant sei es auch, die Forschung durch
ein Folgeprojekt auf weitere und zusammengesetzte Lebensmittel auszuweiten. Zwei mögliche Kandidaten: Trüffel-Butter und Walnuss-Eis.
HINTERGRUND: Food Profiling
Das COMPETENCE NETWORK FOOD PROFILING (CNFP) ist ein wissenschaftliches Verbundprojekt von akademischen Partnerinstitutionen und Wirtschaftsunternehmen. Es wird über einen Zeitraum von
drei Jahren mit insgesamt 3,4 Mio EUR aus Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) gefördert. Schwerpunkt sind Entwicklungen im Bereich der instrumentellen Analytik zur
Authentifizierung von Lebensmitteln.
HINTERGRUND: Beteiligte Forschungspartner
Federführend für das Projekt ist die Hamburg School of Food Science. Dor werden unter anderem Genom-basierte Studien, beispielsweise zur Festlegung der botanischen Identität, gemacht.
Ebenso beteiligt ist das Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München. Am Zentrum für Bioinformatik der Universität Tübingen wird die Software zur
Verarbeitung und Analyse der Daten entwickelt. Weiterhin sind Unternehmen beteiligt, die den Transfer der Verfahren in die Wirtschaft prüfen.
Waldböden sind bessere Kohlenstoffspeicher als erwartet
2019
Pilze im Unterboden ermöglichen langfristige Kohlenstoff-Speicherung / Uni Hohenheim erforscht Mikroorganismen in einer Bodentiefe von bis zu 1,5 Metern / ein Werkstattbericht
Pilze in tiefen Waldbodenschichten sind winzig klein – doch sie besitzen eine große Fähigkeit: Sie können Kohlenstoffe nachhaltig speichern. Dies hat ein Forscherteam der Universität
Hohenheim in Stuttgart herausgefunden. Mit einem aufwändigen Verfahren sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in bislang unerforschte Tiefen vorgedrungen. Das Ergebnis kann für konkrete
Maßnahmen gegen die globale Erderwärmung bedeutend sein. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Projekt der Universität Hohenheim mit insgesamt 411 500 Euro. Damit zählt es zu den
Schwergewichten der Forschung.
Bodenbiologen haben sich in der Vergangenheit bei der Erforschung von Böden lediglich einem Bereich bis zu 30 Zentimeter Bodentiefe gewidmet, weil dort rund die Hälfte der Mikroorganismen wie Pilze
und Bakterien zu finden sind. „Die anderen 50 Prozent liegen darunter in einer Tiefe bis mindestens 1,8 Metern“, erklärt Prof. Dr. Ellen Kandeler vom Institut für Bodenkunde und Standortslehre.
Für ihre Versuche schufen Projektpartner mehrere Observatorien im Grinderwald bei Hannover. 13C markierte Buchenblätter wurde auf diese Observatorien aufgebracht, um das Kohlenstoffsignal bis in den
Unterboden verfolgen zu können.
Das Team um Bodenbiologin Prof. Dr. Kandeler stellt fest: „Der markierte Kohlenstoff wird auch in tiefe Bodenschichten verlagert und dort bevorzugt von Pilzen in ihre Biomasse eingebaut.“
Pilze besitzen eine höhere Kohlenstoffnutzungseffizienz als Bakterien
Diese Erkenntnis war für das Forscherteam völlig neu. „Die Pilze haben eine deutlich höhere Kohlenstoffnutzungseffizienz als Bakterien und tragen somit sehr viel mehr zur Kohlenstoffspeicherung im Unterboden bei als zunächst angenommen“, sagt Prof. Dr. Kandeler. „Während Bakterien den Kohlenstoff sofort wieder verbrennen, sind die Pilze in der Lage ihn längerfristig zu speichern.“
Dies könnte der Wissenschaft bei der Suche nach neuen Möglichkeiten, den Kohlenstoff lange im Boden zu halten um die globale Erderwärmung einzudämmen, nützlich sein. „Da Waldböden reicher an Pilzen sind als andere Böden, könnten diese künftig als ein möglicher Kohlenstoffspeicher dienen“, sagt Prof. Dr. Kandeler.
Die Gefahr lauert im Holz - invasive Käferarten
Die Gefahr lauert im Holz von Paletten oder Kisten aus fernen Ländern: Invasive Käferarten können in Deutschland massive Schäden verursachen. Die Pflanzenschutzdienste kontrollieren solche Import-Sendungen, doch sie haben ein Problem: Es gibt noch keine geeigneten Bestimmungshilfen. Zudem ist über die Tiere oft nur sehr wenig bekannt. Abhilfe verspricht jetzt ein Projekt der Universität Hohenheim in Stuttgart und des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg. Die Forscher rufen dazu auf, Funde des Asiatischen Laubholzbockkäfers und anderer aus Import-Sendungen stammende Käfer an sie zu melden und ihnen die Tiere möglichst unbeschädigt zuzusenden. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) fördert über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) das Vorhaben in Hohenheim mit fast 327.000 Euro und macht es damit zu einem Schwergewicht der Forschung.
Er misst nur wenige Zentimeter, sieht hübsch aus – und kann ganze Dörfer in einen Ausnahmezustand versetzen: Der Asiatische Laubholzbockkäfer gilt als gefährlicher Eindringling. Nicht ohne Grund, denn der Käfer kann kerngesunde Bäume zum Absterben bringen. Wie 2016 in Hildrizhausen rückt man ihm daher rund um die Befallsstellen mit Suchtrupps und Spürhunden zu Leibe. Fällungen aller in einer EU-Richtlinie spezifizierten Laubbäume im Umkreis von 100 Metern – auch in Privatgärten – sollen den flugfaulen Quarantäneschädling aufhalten. Das ist sehr aufwändig und teuer. „Es stellt sich die Frage, ob ein solches Vorgehen den Käfer langfristig tatsächlich stoppen kann“, gibt Prof. Dr. Martin Hasselmann, Leiter des Fachgebiets Populationsgenomik bei Nutztieren an der Universität Hohenheim, zu bedenken. „Doch um das zu beurteilen, müssen wir mehr über die Tiere wissen – und nicht zuletzt auch eine genaue Artenbestimmung ermöglichen.“ Gemeinsam mit dem Kollegen Olaf Zimmermann vom Landwirtschaftlichen Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) und dem Hohenheimer Entomologen Professor Claus Zebitz arbeitet das Team um Professor Hasselmann daher an neuen, schnelleren Bestimmungsverfahren für die Käfer.
Genetische Unterschiede geben Aufschluss über die Herkunft
Der nahliegende Verdacht der Forscher: Über Verpackungsholz gelangen die Schädlinge nach Europa. „Doch ob hier bereits eine Population etabliert ist, die sich selbstständig ausbreitet, oder ob die
verschiedenen Fundstellen unabhängig voneinander eingeschleppt wurden, das wissen wir nicht“, bedauert Iris Häußermann, Doktorandin an der Universität Hohenheim. Um diese Fragen zu klären kommt den
Forschern zugute, dass das Erbgut des Laubholzbockkäfers bereits bekannt ist. Nun sammeln sie genetisches Material von allen Fundstellen in Deutschland und ergänzen es mit Proben aus Museen, von
Hobby-Entomologen und aus der ostasiatischen Heimat der Tiere.
„Wir vergleichen das Material und können so feststellen, woher genau die Käfer ursprünglich kommen. Und wir untersuchen, ob die Tiere von verschiedenen Fundstellen miteinander verwandt sind – was auf
eine selbstständige Ausbreitung hindeuten würde“, erklärt Prof. Dr. Hasselmann. Mit diesen Erkenntnissen wollen die Wissenschaftler dann gezieltere Gegen- und Präventivmaßnahmen beim Import
ermöglichen. „Das spart Monitoringkosten und sichert den Bekämpfungserfolg.“
Bestimmungsschlüssel für über 100 Käferarten an Verpackungsholz
Der Asiatische Laubholzbockkäfer ist zwar ein recht prominenter Vertreter der invasiven Arten, doch bei weitem nicht der einzige. „Unsere Vorgehensweise beim Laubholzbockkäfer lässt sich auf andere
Arten übertragen“, betont Prof. Dr. Hasselmann. „Es gibt im Importholz viele weitere, wirtschaftlich schädliche Käferarten, die weltweit jährlich Schäden in Millionenhöhe anrichten.“ Doch Bock-,
Bohr- und Splintholzkäfer seien bei den Kontrollen oft nur schwer zu identifizieren. „Es fehlen uns genaue Bestimmungsschlüssel. Und häufig findet man auch zum Beispiel nur zerquetschte Larven, die
man gar nicht mehr unter dem Mikroskop erkennen kann“, gibt Dr. Zimmermann vom LTZ Augustenberg zu bedenken.
Für über 100 dieser Arten trägt das Projektteam nun Daten und Informationen aus aller Welt zusammen, um eine frei zugängliche Datenbank aufzubauen. Sie soll die mikroskopischen Merkmale der Käfer und
ihre genetischen Daten enthalten. Daran arbeitet Philipp Bauer, der zweite Doktorand an der Universität Hohenheim und dem LTZ, im Rahmen dieses Projektes. Das Ziel der Forscher: Einerseits ein
Bestimmungsschlüssel, der auf den äußeren Merkmalen der Tiere basiert, und zum anderen eine Methode, bei der über sogenannte genetische Marker, also über das Erbgut, die Identifizierung
erfolgt.
Forscher erbitten Fundmeldungen des Asiatischen Laubholzbockkäfers
Am Ende des Projektes will das Team die Ergebnisse den Pflanzenschutzdiensten und anderen Dienstleistern online und in gedruckter Form frei zur Verfügung stellen. Geplant sind außerdem Workshops zur
Praktikerschulung. „Denn das Problem wird in Zeiten des Klimawandels und der Globalisierung in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch zunehmen“, betont Prof. Dr. Hasselmann. „Eine sichere und
schnelle Bestimmung der Arten ist sehr wichtig, um rasch Gegenmaßnahmen ergreifen zu können.“ Bis dahin sind die Forscher für alle Meldungen von Funden oder Befallsorten des Asiatischen
Laubholzbockkäfers dankbar: Sie können per E-Mail unter PHID-Coleo@ltz.bwl.de oder telefonisch unter 0721 9468-0 gemeldet
werden. Um auch die praktische Arbeit der Forscher zu unterstützen, sollten die Tiere und weitere verdächtige Käfer aus Verpackungsholz möglichst unbeschädigt an Zimmermann im LTZ gesendet
werden.
Hintergrund: Verbundprojekt: Morphologisch-molekulare Identifikation von Käferarten an Verpackungsholz im Bereich der Pflanzengesundheit (PHID-Coleo)
Das Projekt „Morphologisch-molekulare Identifikation von Käferarten an Verpackungsholz im Bereich der Pflanzengesundheit (PHID-Coleo)“ startete am 15.6.2017 und hat eine Laufzeit bis 14.6.2020. Das
Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) fördert es durch die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) als Projektträger mit 326.959 Euro für die Universität Hohenheim
und 51.623 Euro für den Projektpartner, das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg (LTZ).
Viel Lebensraum für Bären in Europa
18.08.2018
Auf zusätzlich rund 380.000 Quadratkilometern könnten Braunbären leben – auch in Deutschland
Leipzig/Halle. Große Chance für europäische Braunbären: Eine neue Studie unter Leitung des Deutschen Zentrums für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) zeigt, dass es in Europa viele Gebiete gibt, in denen keine Bären mehr leben, die sich aber grundsätzlich wieder als Lebensraum eignen würden. Nachdem sich die potentiellen Lebensbedingungen für Bären in vielen europäischen Staaten verbessert haben – zum Beispiel durch weniger Bejagung – sei es wahrscheinlich, dass künftig Tiere in einige dieser Gebiete einwanderten, so der Studienleiter. Wichtig sei es nun, vorausschauend Maßnahmen zu ergreifen, um Konflikte zwischen Bären und Menschen zu vermeiden.
Vor 500 Jahren gab es noch fast überall in Europa Braunbären. Doch in den folgenden Jahrhunderten wurden sie vielerorts ausgerottet, so auch in Deutschland. Gründe für den Rückgang der Bären waren der Verlust an Lebensraum und Bejagung. Heute leben noch rund 17.000 Tiere in Europa, verteilt auf zehn Populationen und 22 Staaten. Einige dieser Populationen sind aufgrund ihrer vergleichsweise geringen Größe gefährdet.
Große Chance für den Artenschutz
In den vergangenen Jahren wurde die Jagd auf Braunbären in Europa verboten oder stark eingeschränkt. Künftig könnten sich Bären wieder ausbreiten. Denn eine neue Studie unter der der Leitung des Deutschen Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung (iDiv) und der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU) zeigt: Es gibt noch viele Gebiete in Europa, in denen es derzeit zwar keine Bären gibt, die sich aber grundsätzlich als Lebensraum für Bären eignen würden. Von über einer Million Quadratkilometern geeignetem Lebensraum in Europa sind rund 37 % nicht besiedelt, was einer Fläche von rund 380.000 Quadratkilometern entspricht. In Deutschland gibt es 16.000 Quadratkilometer potentiellen Bären-Lebensraum. Allerdings sind die Wahrscheinlichkeiten einer Wiederbesiedlung durch den Bären sehr unterschiedlich. In Deutschland zum Beispiel sind geeignete Lebensräume außerhalb der Alpen geografisch isoliert, so dass dort eine natürliche Rückkehr des Bären unwahrscheinlich ist.
„Dass es noch geeigneten Lebensraum für Braunbären gibt, ist eine große Chance für den Artenschutz“, sagt Studienleiter Dr. Néstor Fernández vom Forschungszentrum iDiv und der Universität Halle. Bereits heute beobachten Wissenschaftler, dass sich rund 70 % der Populationen in Europa erholen, und es ist anzunehmen, dass Bären in noch unbesetzte Gebiete einwandern werden. „Auch in Deutschland ist es sehr wahrscheinlich, dass einige Gebiete früher oder später wieder von Braunbären besiedelt werden, vor allem in der Alpenregion“, so Fernández. Es besteht also begründete Hoffnung, dass Bären 200 Jahre nach ihrer Ausrottung in Deutschland wieder heimisch werden.
Vorausschauendes Handeln wichtig
Für viele Menschen wäre dies wahrscheinlich eine gute Nachricht. „In den vergangenen Jahren hat sich die Einstellung der Bevölkerung gegenüber Wildtieren sehr gewandelt. Heute stehen viele Menschen der Rückkehr großer Säugetiere positiv gegenüber“, sagt Fernández. Dass die Einwanderung von Bären dennoch auch zu Konflikten mit menschlichen Aktivitäten führen kann, sei eine Tatsache, die es frühzeitig zu bedenken gebe. Solche Konflikte entstehen vor allem dann, wenn Bären Feldfrüchte fressen oder Bienenstöcke beschädigen, gelegentlich reißen sie auch Schafe. Direkte Angriffe von Bären auf Menschen passieren hingegen äußerst selten. Die Bären selbst gehen Menschen gewöhnlich aus dem Weg.
Mit der Karte, die Fernández und seine Kollegin Anne Scharf (Max-Planck-Institut für Ornithologie) erstellt haben, lässt sich abschätzen, in welchen Gebieten Bären wieder leben könnten. Dies könnte der Politik helfen, mögliche Konflikte frühzeitig zu erkennen und diesen mit gezielten Maßnahmen entgegenzuwirken. So sollte man zum Beispiel Ausgleichszahlungen daran koppeln, dass vorab Schutzmaßnahmen ergriffen wurden, erklärt Fernández. Solche Schutzmaßnahmen können das Aufstellen von Stromzäunen sein, die Bewachung von Äckern oder Viehweiden durch Schutzhunde sowie der Dialog mit der Bevölkerung. Ein Blick auf die Karte macht zudem deutlich: Bären halten sich nicht an Staatsgrenzen. „Daher wäre ein gemeinsames Management des Braunbären sowie anderer Wildtiere auf europäischer Ebene wünschenswert“, sagt Fernández. Derzeit ist die Gesetzgebung in Bezug auf Schutz und Bejagung der Bären von Staat zu Staat sehr unterschiedlich, und auch die Zahlung von Entschädigungen ist verschieden geregelt.
Europaweite Karte
Für ihre Studie haben Scharf und Fernández die Ergebnisse von sechs vorangegangenen Arbeiten berücksichtigt. Diese hatten sich jeweils auf ein begrenztes Gebiet konzentriert, in dem Bären leben, und für dieses analysiert, welche Ansprüche die Tiere an ihren Lebensraum haben. Indem die Wissenschaftler die Ergebnisse dieser lokalen Studien zusammenführten, konnten sie ein Computermodell erstellen, mit dem sie für ganz Europa mögliche weitere Lebensräume für Bären bestimmten. Die Voraussagen dieses Modells sind zuverlässiger, als wenn nur Daten aus einer Region auf ganz Europa übertragen würden. Ihre Ergebnisse haben Scharf und Fernández am 09. Juli 2018 in der Fachzeitschrift Diversity and Distributions publiziert. Tabea Turrini
Originalpublikation:
Anne K. Scharf und Néstor Fernández (2018): Up-scaling local-habitat models for large-scale conservation: Assessing suitable areas for the brown bear comeback in Europe. Diversity and Distributions. Doi: doi.org/10.1111/ddi.12796
Ausweitung Energiepflanzenanbau f. Natur schädlich wie Klimawandel
12.2018
Um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, wird aber davon ausgegangen, dass
Bioenergie-Pflanzen großflächig angebaut werden müssen. Neuen Modellen
zufolge werden dadurch insgesamt mehr Lebensräume von Wirbeltieren
vernichtet als von einem abgeschwächten Klimawandel profitieren,
berichten Forschende des Senckenberg Biodiversität und Klima
Forschungszentrums, der Technischen Universität München und der Durham
University soeben im Fachblatt „Proceedings of the National Academy of
Sciences". Der vermeintliche Vorteil eines solchen Klimaschutzes käme
daher den Arten nicht zugute. Damit die Globaltemperatur bis 2100 um nicht mehr als 1,5 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitraum steigt, muss die Menge an
CO2, die rund um den Globus in die Luft geblasen wird, deutlich sinken.
Eine Begrenzung des Klimawandels nützt auch der Natur, denn er ist einer
der Ursachen für das Artensterben. Ein aktuell verbreiteter Ansatz dazu
ist es, mehr Energie aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Raps,
Ölpalme und Co. statt aus fossilen Rohstoffen zu gewinnen.
Doch damit – legt man das Augenmerk auf die biologische Vielfalt –
ersetzt man wohl ein Übel durch ein anderes. „Um den Klimawandel damit
wirksam zu begrenzen, müssen wir bis 2100 auf circa 4,3 Prozent der
globalen Landflächen Bioenergie-Pflanzen anbauen – das entspricht fast
der 1,5-fachen Fläche aller EU-Länder zusammen. Damit schaden wir der
biologischen Vielfalt, die in diesen Gebieten bisher zuhause ist,
gravierend. Die negativen Auswirkungen des Klimawandels, die mit
maximaler Bioenergie-Nutzung verhindert werden könnten, werden diese
Verluste nicht wettmachen", so Dr. Christian Hof, der die Studie am
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum Frankfurt
durchführte und jetzt an der TU München forscht.
Unter Wissenschaftlerlnnen ist Bioenergie schon länger umstritten und
war bisher Gegenstand von Einzelstudien. Hof und sein Team haben
erstmals global untersucht, wie Amphibien, Vögel und Säugetiere den
Klima- und den Landnutzungswandel bis 2100 zu spüren bekommen. Dabei
haben sie zwei Szenarien miteinander verglichen: ein Szenario mit
maximaler Bioenergie-Nutzung, welches einer Begrenzung der Erwärmung um
circa 1,5 Grad entspricht, und ein Szenario mit minimaler
Bioenergie-Nutzung und einem Temperaturanstieg um etwa 3 Grad gegenüber
dem vorindustriellen Zeitraum bis 2100.
Die Ergebnisse überraschen: „Ob sich die Temperatur bis 2100 um 1,5
oder 3 Grad erhöht: Rund 36 % der Lebensräume von Wirbeltieren sind
entweder durch den Klimawandel oder die neue Landnutzung infolge des
Anbaus von Bioenergie-Pflanzen massiv gefährdet. Die Auswirkungen auf
die biologische Vielfalt sind also vergleichbar. Unterschiedlich ist
nur, auf wessen Konto sie gehen", erklärt Dr. Alke Voskamp vom
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum.
Darüber hinaus gibt es Gebiete, in denen Wirbeltieren von
Energiepflanzen-Plantagen der Platz streitig gemacht wird und ihnen
gleichzeitig die höhere Temperatur zu schaffen machen wird. „Bei einem
geringeren Temperaturanstieg bis 1,5 Grad, den wir durch die maximale
Nutzung von Bioenergie erkaufen, könnten sogar größere Flächen unter
dieser Doppelbelastung leiden. Unter diesem 1,5 Grad-Szenario wird
insgesamt ein größerer Anteil der Verbreitungsräume von Wirbeltieren
durch Klimawandel, Landnutzung oder beides beeinträchtigt“, erklärt
Voskamp.
Das Abbremsen des Klimawandels durch den Einsatz von
Bioenergie-Pflanzen schadet zudem wahrscheinlich deutlich mehr
Wirbeltierarten mit kleinem Verbreitungsgebiet, als ein
Temperaturanstieg um 3 Grad. Solche Wirbeltierarten – vor allem
Amphibien – leben mehrheitlich in den Tropen und Neotropen. An diesen
Orten jedoch werden Plantagen für Bioenergie-Pflanzen am meisten
zunehmen.
Für Hof und sein Team lässt die Studie nur einen Schluss zu: „Der
Klimawandel ist nach wie vor eine der größten Bedrohungen für die
biologische Vielfalt und muss möglichst auf 1,5 Grad Temperaturerhöhung
begrenzt werden. Wie unsere Studie zeigt, ist die Bioenergie und die
massive Ausweitung der Anbauflächen hierfür aber der falsche Weg. Wir
müssen stattdessen stärker daran arbeiten, Energie einzusparen."
Kontakt
Dr. Christian Hof
Technische Universität München & Senckenberg Biodiversität und Klima
Forschungszentrum
Tel. 08161 712489
Christian.hof@tum.de
Dr. Alke Voskamp
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum
Tel. 069 7542 1871
alke.voskamp@senckenberg.deeld >>
Größere Artenvielfalt in Wiesen = umfangreicheren Dienstleistungen d. Ökosysteme
08.2016
Je mehr es wimmelt, kreucht und fleucht, desto besser für den Menschen, der von den vielfältigen, kostenlos erbrachten Dienstleistungen der Natur profitiert. Das ist das
Ergebnis einer Studie von über 300 Forschenden unter anderem des
Instituts für Pflanzenwissenschaften der Universität Bern und des
Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt. Ein
artenreiches und von vielen Individuen aus allen Ebenen der
Nahrungskette bevölkertes Ökosystem erbringt demnach die umfangreichsten
Ökosystemdienstleistungen, berichtet das Team heute im Fachjournal
„Nature“. Besonders wichtig sei auch die Vielfalt der beim Menschen
eher unbeliebter Insekten und die Vielfalt unscheinbarer
Bodenorganismen. Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit des
Erhalts artenreicher Ökosysteme zum Wohl des Menschen.
Eine blühende Wiese – neben dem ästhetischen Wert dieser Ökosysteme
erbringt die Natur auch jeden Tag handfeste, kostenlose Dienstleistungen
für den Menschen. Dazu zählen unterstützende Leistungen wie
beispielsweise die Bodenbildung, Versorgungsleistungen wie die
Lebensmittelproduktion, Regulierungsleistungen wie Schädlingsbekämpfung
und Klimaregulierung und kulturelle Leistungen wie beispielweise der
Nutzen der Ökosysteme als Erholungsraum. Diese komplexen Ökosysteme
setzen sich aus verschiedenen sogenannten trophischen Gruppen respektive
Gliedern in der Nahrungskette zusammen. Welchen Einfluss die schwindende
Artenvielfalt auf die Ökodienstleistungen hat, wurde bislang lediglich
anhand einzelner leicht zu untersuchender trophischer Gruppen wie
Pflanzen studiert.
Ein 300-köpfiges internationales Forscherteam um Dr. Santiago Soliveres
von der Universität Bern hat daher erstmals alle Gruppen entlang einer
Nahrungskette in einer natürlichen Graslandschaft untersucht. Sie
sammelten dazu Daten zu insgesamt 4600 Tier- und Pflanzenarten aus neun
Gruppen der Nahrungskette; darunter auch zu bislang eher
vernachlässigten Arten wie Mikroorganismen, die den Boden zersetzen
und Abfallfressern wie Regenwürmern. Erhoben wurden die Daten als Teil
eines von der Deutsche Forschungsgemeinschaft geförderten Programms auf
150 Grünlandflächen quer durch Deutschland, den
„Biodiversitätsexploratorien“, die die umfassendsten
ökologischen Freilandversuchsflächen Europas darstellen.
Artenvielfalt innerhalb aller trophischer Gruppen notwendig
„Wie bei einem Puzzle haben wir uns ein zusammenhängendes Bild davon
gemacht, wie bedeutsam einzelne trophische Gruppen für vierzehn von uns
gemessene Ökosystemdienstleistungen sind. Jede Ökosystemdienstleistung
ist demnach von mindestens drei Gruppen abhängig. Je vielfältiger die
Arten innerhalb der Gruppe, desto zuverlässiger wird die
Ökosystemdienstleistung erbracht. Außerdem beeinflusst jede einzelne
Gruppe zumindest eine Ökosystemdienstleistung“, fasst Soliveres,
Erstautor der Studie, die Ergebnisse zusammen.
Dr. Peter Manning vom Senckenberg Biodiversität und Klima
Forschungszentrum ergänzt: „Wir müssen also Artenreichtum in mindestens
drei der untersuchten Gruppen der Nahrungskette sicherstellen. Es sind
aber nicht immer die gleichen drei Gruppen, die für das Funktionieren
einer individuellen Ökosystemdienstleitung maßgeblich sind. Deshalb muss
der Artenreichtum in allen Gruppen der Nahrungskette erhalten bleiben,
damit die Natur zuverlässig weiter für uns im Verborgenen ‚arbeitet‘
wie wir es gewohnt sind.“ Hohe Artenvielfalt über alle Gruppen hinweg
ist besonders wichtig für regulierende Prozesse sowie kulturelle
Dienstleistungen.
Die Wichtigkeit von „Schädlingen“
Die Studie zeigt zudem, wie wichtig auch vermeintliche Schädlinge und
unscheinbare Dienstleister sind. Viele Insekten und Bodenorganismen
spielen nämlich, neben Pflanzen, so die Studie, eine zentrale Rolle bei
den Leistungen, die Natur für uns erbringt. „Pflanzen liefern Biomasse,
die den Anfang der Nahrungskette bildet, aber Insekten wirken als
Bestäuber und Bodenorganismen erhöhen durch Zersetzung und Rückhalt
von chemischen Elementen wie Phosphor die Bodenfruchtbarkeit. Je mehr
und je unterschiedlichere Individuen es besonders innerhalb dieser drei
Gruppen gibt, desto positiver wirkt sich das auf alle Dienstleistungen
aus“, erklärt Soliveres.
Häufig wird der Boden gedüngt, um die Bodenfruchtbarkeit und damit das
Wachstum von Pflanzen zu erhöhen. Kurzfristig hilft Dünger zwar, wenn
dabei aber die Artenvielfalt verringert wird, überwiegen die Nachteile.
Eine hohe Artenvielfalt entlang der gesamten Nahrungskette zu erhalten,
ist langfristig gesehen daher preiswerter und sinnvoller, als sie zu
zerstören.
Bedeutung biologischer Vielfalt für Ökosystemdienstleistungen bisher
unterschätzt
„Wenn biologische Vielfalt rapide zerstört wird, welche Konsequenzen
hat das für die Menschen? Welche Handlungsoptionen gibt es? Das ist
bisher nicht umfassend genug erforscht und einer der Gründe, warum der
internationale Biodiversitätsrat IPBES gegründet wurde“, führt Prof.
Markus Fischer, Leiter des Forschungsprojektes vom Institut für
Pflanzenwissenschaft der Universität Bern und Senckenberg Biodiversität
und Klima Forschungszentrum aus. Die beispielhafte Studie zeige auch,
dass in der bisherigen Forschung, die nur auf einzelne trophische
Gruppen fokussierte, die Bedeutung biologischer Vielfalt über alle
Gruppen einer Nahrungskette hinweg unterschätzt worden sei: „Unser
umfassendes Forschungsprogramm demonstriert, wie wichtig es ist, den
Gesamtzusammenhang zu untersuchen und dass Handlungsbedarf zum Schutz
der Ökosysteme besteht“, resümiert Fischer.
Kontakt
Dr. Santiago Soliveres (nur Englisch)
Institut für Pflanzenwissenschaften, Universität Bern
Tel. +41 31 631 49 23
santiago.soliveres@ips.unibe.c
Prof. Dr. Markus Fischer (Deutsch und Englisch)
Institut für Pflanzenwissenschaften
Universität Bern
Tel. +41 31 631 49 43
markus.fischer@ips.unibe.chues Textfeld >>